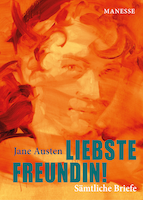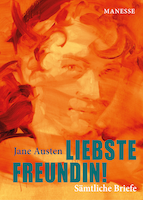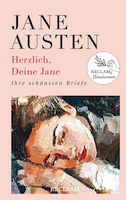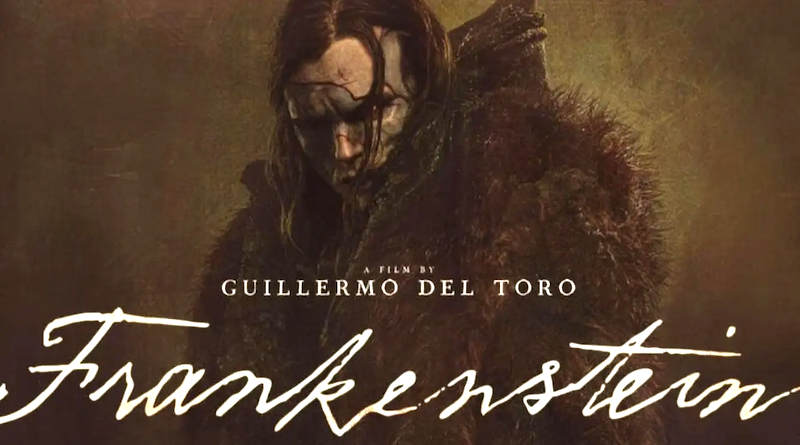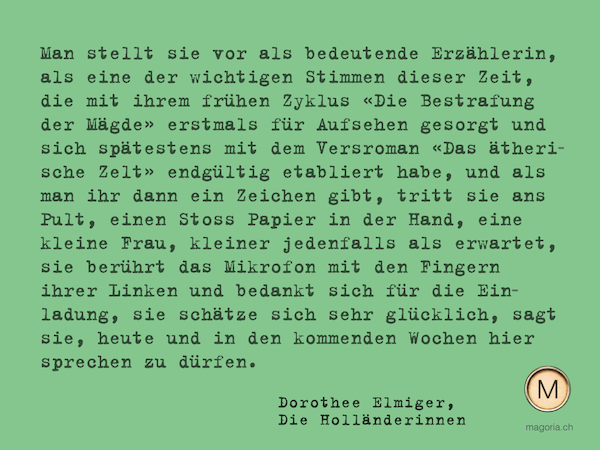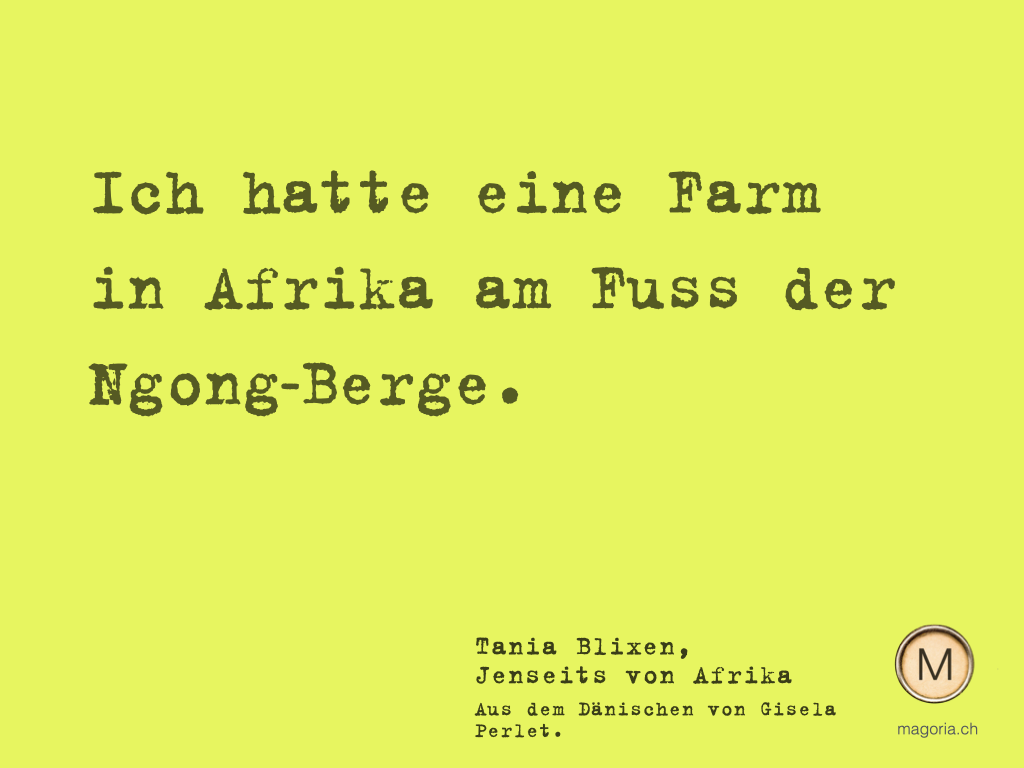
Tania Blixen (auch Karen Blixen oder Isak Dinesen) beginnt ihr Erinnerungsbuch mit einer schlichten Feststellung: «I had a farm in Africa, at the foot of the Ngong Hills.» Das könnte der Auftakt zu einem Erfahrungsbericht sein. Es folgt jedoch keine literarische Reportage. Vielmehr erzählt der stark autobiografische Roman Out of Africa von einer verlorenen Welt. Karen Blixen war 1914 mit ihrem Mann nach Nairobi gereist, um in Britisch-Ostafrika eine Kaffeeplantage zu betreiben. Nach dem Scheitern dieses Vorhabens und dem finanziellen Ruin kehrt sie 1931 zurück nach Dänemark. Vor dem Hintergrund dieses Verlustes klingt der erste Satz eher nach Wehmut oder Nostalgie. Er kündigt einen «abgeklärten Rückblick aus zeitlicher und räumlicher Entfernung auf eine vergangene und schon im Untergang befindliche Welt an», wie Jürg Glauser im Nachwort zu einer älteren Übersetzung schreibt.
Die mittellose und gesundheitlich angeschlagene Baronin Blixen lebt wieder im Haus der Familie. Sie beginnt mit dem Schreiben und beabsichtigt, mit ihrem Erzählband Seven Gothic Tales bei einem grossen Verlag in England unterzukommen und bald ihr eigenes Geld zu verdienen.
Verfügbar in der arte-Mediathek bis 30.11.2026.
Die Mini-Serie The Dreamer: Becoming Karen Blixen (2022) zeichnet ihren Weg aus der Misere und zum internationalen Erfolg in sechs Episoden nach. Der Untertitel ruft andere Biopics in Erinnerung, die sich, wie die englischen Titel nahelegen, ebenfalls dem Werdegang und Aufstieg berühmter Autorinnen widmen: Becoming Colette (1991), Becoming Jane (2007), Becoming Astrid (2018).
Zur typischen Heldinnenreise gehört auch in The Dreamer, dass der leidvolle Weg zum Ruhm von Hindernisse und herben Rückschlägen geprägt ist. Die Schauspielerin Connie Nielsen beeindruckt in der Rolle der eigensinnigen und kompromisslosen Kämpferin. Überzeugt von der Qualität ihrer Arbeit, setzt Karen Blixen alles daran, ihren Willen durchzusetzen. Sie lässt Beziehungen spielen und stösst ihr Umfeld durch eigennütziges Vorgehen immer wieder vor den Kopf. Das Schreiben und der geplante Erfolg haben stets Vorrang. Hier lernen wir also eine härtere und weniger sympathische Autorin kennen als in Sydney Pollacks opulentem Out of Africa (1985) mit Meryl Streep in der Hauptrolle.
Am Ende schlägt man sich in The Dreamer dennoch auf die Seite der Autorin, bewundert ihr Genie, ihre Unbestechlichkeit und Zielstrebigkeit. Immerhin hat sie mit ihren Erzählungen Literaturgeschichte geschrieben. Das weckt die Lust, den 1938 unter dem Pseudonym Isak Dinesen erschienen Roman Out of Africa zu lesen und neu zu entdecken. Dafür sind Biopics über Schriftsteller:innen schliesslich auch da – ob die Ausnahmetalente nun Austen, Colette oder Blixen heissen.
Daniel Ammann, 17.1.2026
«Blixens Afrikaroman ist längst zu einem Klassiker des 20. Jahrhunderts geworden, sein viel zitierter Beginn Ausweis für ihre faktenorientierte und unprätentiöse Erzählweise. Er ist ein Buch des Abschieds, ein Buch, aus dem man sterben lernen kann – und lieben.» – Denis Scheck

Tania Blixen
Jenseits von Afrika: Memoiren.
Aus dem Dänischen von Gisela Perlet.
Mit Nachwort von Ulrike Draesner.
München: Penguin, 2021. 688 Seiten.