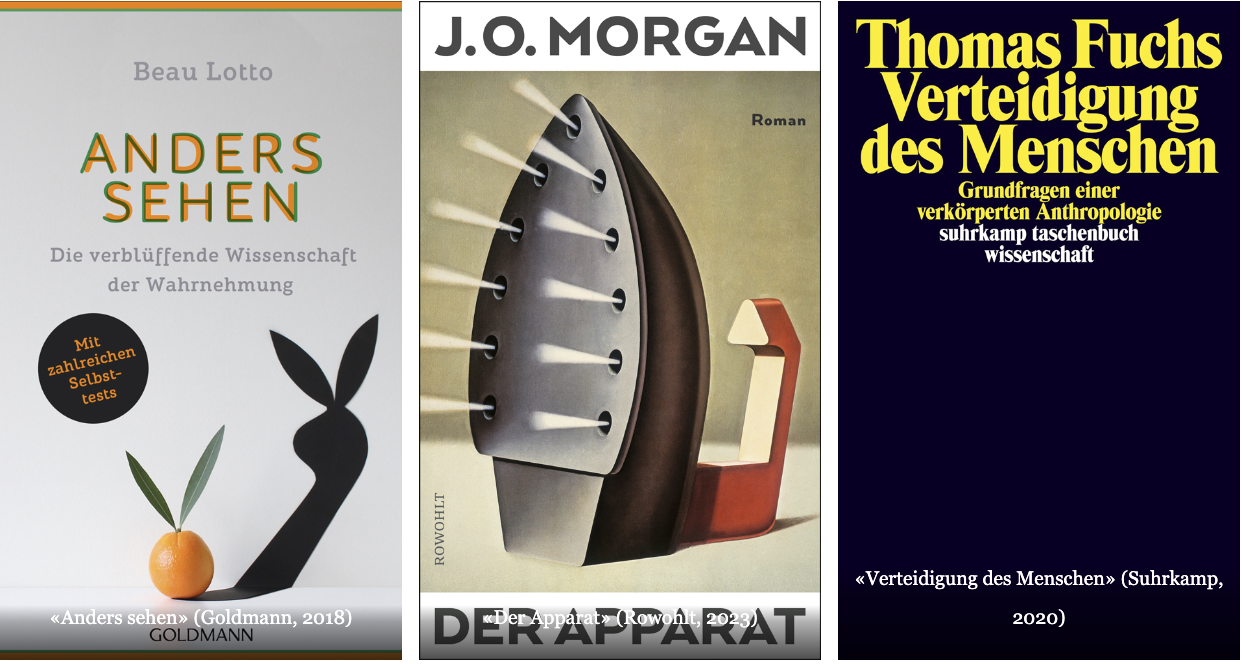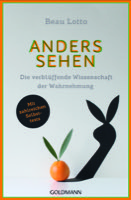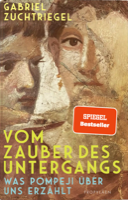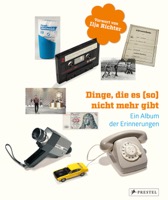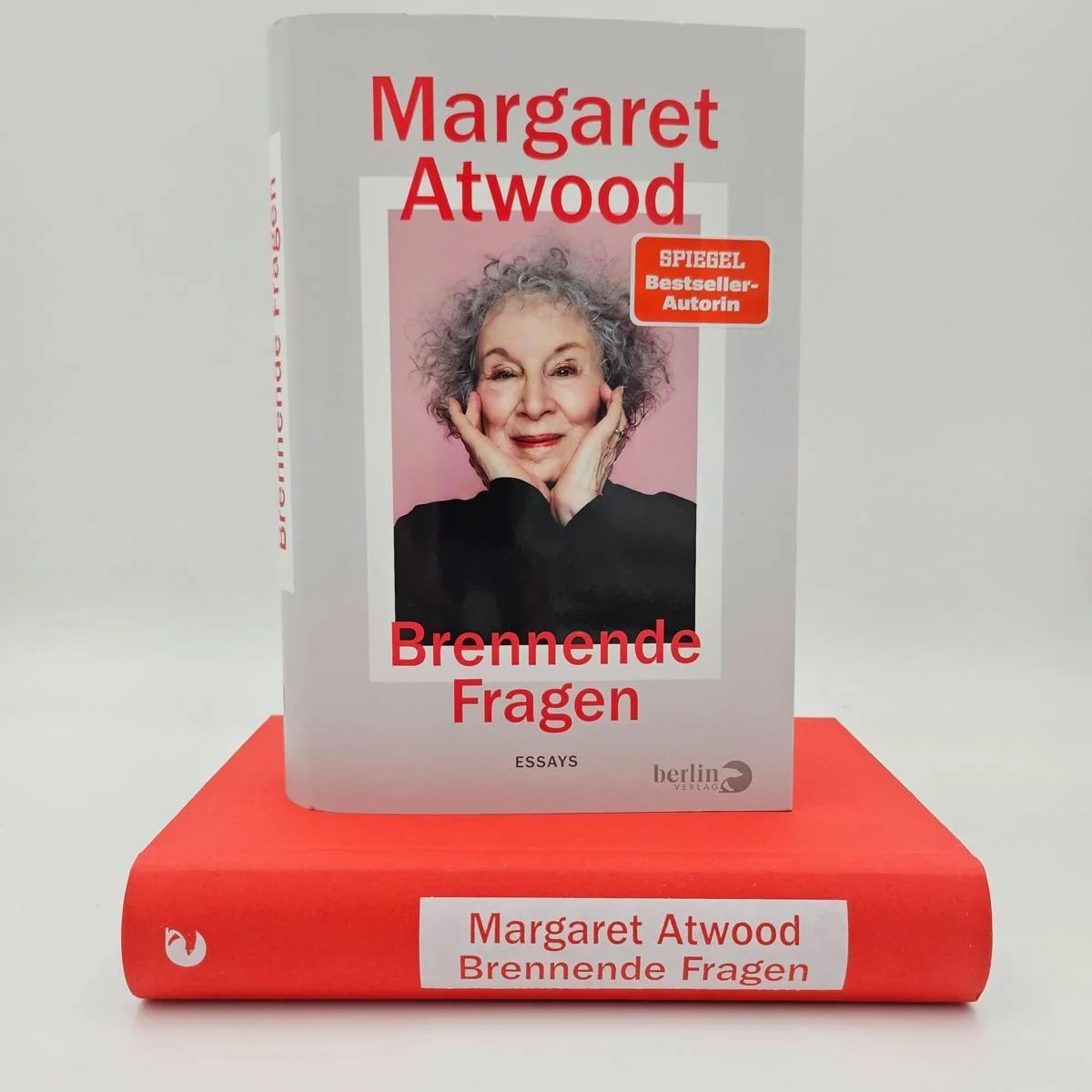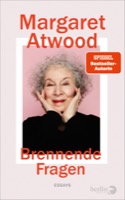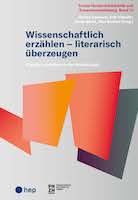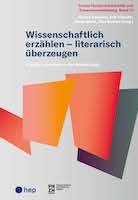« Digitale Schieflage.»
Akzente 3 (2024): S. 34.![]() blog.phzh.ch/akzente/2024/08/23/digitale-schieflage
blog.phzh.ch/akzente/2024/08/23/digitale-schieflage![]() Download
Download
Barrierefreie Demokratie oder Informationsapokalypse? In ihren scharfsinnigen Essays zur Digitalmoderne räumt Eva Menasse mit der Vorstellung auf, Medien seien bloss Werkzeuge und somit für die von Menschen angerichteten Verheerungen nicht verantwortlich. Soziale Medien und manipulative Programme hätten in ihrer Wirkung indes mehr mit bewusstseinsverändernden Drogen als mit harmlosen Werkzeugen gemein.
Dass wir mit einfachen Zuschreibungen nicht weit kommen und vielleicht nicht viel dazugelernt haben, zeigt die Autorin unter anderem in ihrer Analyse der deutschen Antisemitismus-Debatte. Digitale Massenkommunikation scheint alles zu erfassen und hat innerhalb weniger Jahre menschliches Leben und Verhalten von Grund auf verändert. Dennoch: Die analoge Welt gibt es noch, wie sie mehrfach betont: «Dort stinken die Mülltonnen und müssen die Nabelschnüre Neugeborener händisch von Erwachsenen durchschnitten werden.»
– Daniel Ammann

Eva Menasse
Alles und nichts sagen: Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne.
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2023. 192 Seiten.