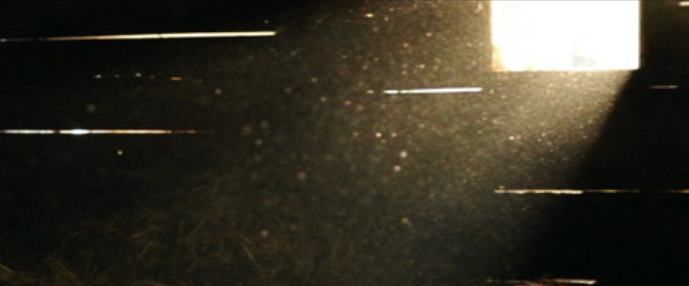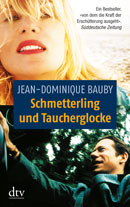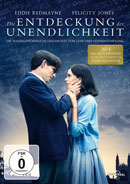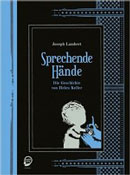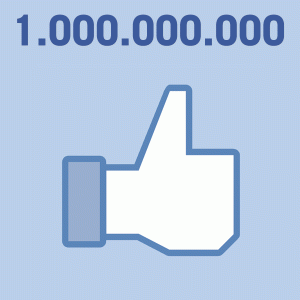Am 16. Dezember 2025 feiern wir den 250. Geburtstag der britischen Autorin Jane Austen. 2017 (anlässlich ihres 200. Todestages) erschien bei Manesse eine Neuübersetzung ihres ersten Romans Sense and Sensibility (1811). Das war damals ein Anlass für mich, den ersten Satz genauer unter die Lupe zu nehmen und mit den bisherigen Übertragungen zu vergleichen. Ins Rennen steigen Ruth Schirmer, Erika Gröger, Angelika Beck, Ursula und Christian Grawe, Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié sowie Helga Schulz.
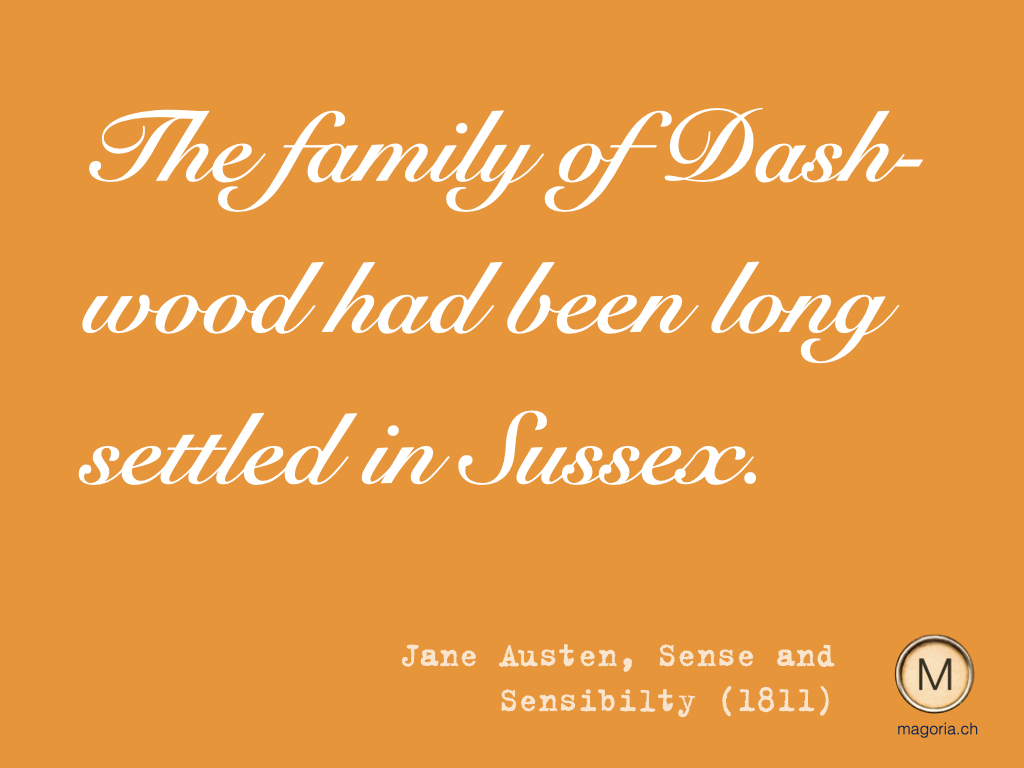
Die acht deutschen Übersetzungen bringen es erstaunlicherweise auf sieben unterschiedliche Varianten.
Vier Mal ist von der «Familie Dashwood» die Rede. In den übrigen Fällen heisst es einfach «Die Dashwoods». Etwas aus der Reihe tanzt die Diogenes-Übersetzung von Erika Gröger: «Die Dashwoods waren eine alteingesessene Familie in Sussex.» Es ist die einzige Übertragung, die für «had long been settled» nicht auf das Wort «ansässig» zurückgreift. In den übrigen Fällen wird die Dauer in kleinen Variationen wiedergegeben: «schon lange», «schon seit langem», «seit langem», «seit langer Zeit schon» und «lange … gewesen».
Die Familie Dashwood war schon lange in Sussex ansässig.
Andrea Ott (Manesse 2017)
Die Dashwoods waren eine alteingesessene Familie in Sussex.
Erika Gröger (Aufbau-Verlag 1972, Diogenes 1991)
Die Familie Dashwood war seit langem in Sussex ansässig.
Ursula u. Christian Grawe (Reclam 1982, 2025)
Die Dashwoods waren lange in Sussex ansässig gewesen.
Ruth Schirmer (Manesse 1984, btb 2011)
Seit langer Zeit schon war die Familie Dashwood in Sussex ansässig.
Angelika Beck (Insel 1991, 2025)
Die Dashwoods waren seit langem in Sussex ansässig.
Rosemarie Bosshard (Goldmann 1998, btb 2000)
Die Familie Dashwood war schon seit langem in Sussex ansässig.
Helga Schulz (dtv 2000)
Die Dashwoods waren seit langem in Sussex ansässig.
Manfred Allié u. Gabriele Kempf-Allié (S. Fischer 2012)
Übrigens: Der alliterative Titel Sense and Sensibility bleibt am ehesten noch in den Titeln zweier Filmadaptionen erhalten: Sinn und Sinnlichkeit. Die deutschen Buchtitel warten wiederum mit Variation auf: Verstand und Gefühl – Vernunft und Gefühl – Gefühl und Vernunft – Gefühl und Verstand.
Es war auch nicht zu erwarten, dass man einen Roman Kognition und Emotion betitelt.
Oder schlicht: Kopf und Herz.
Daniel Ammann, 20.7.2017/17.10.2025
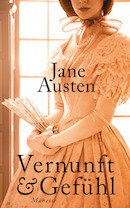
Jane Austen
Vernunft und Gefühl.
Aus dem Englischen von Andrea Ott. Nachwort von Denis Scheck.
Zürich: Manesse, 2017. 416 Seiten.

Jane Austen
Verstand und Gefühl.
Aus dem Englischen übersetzt von Ursula und Christian Grawe.
Nachwort u. Anmerkungen von Christian Grawe.
Überarbeitete und akutalsierte Ausgabe.
Ditzingen: Reclam, 2025.
512 Seiten.
Siehe auch den Medientipp «Austen für alle» in Akzente 4 (2017): S. 35 und den Essay «Wie lispelt man auf Deutsch?» in der NZZ vom 7.12.2019, S. 47.
Alle Beiträge zu Jane Austen: