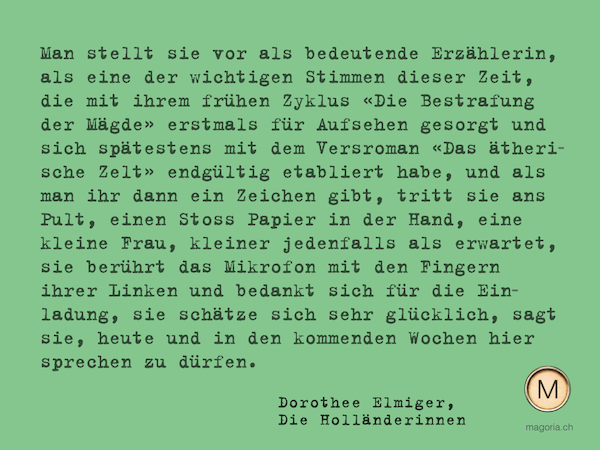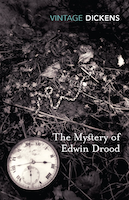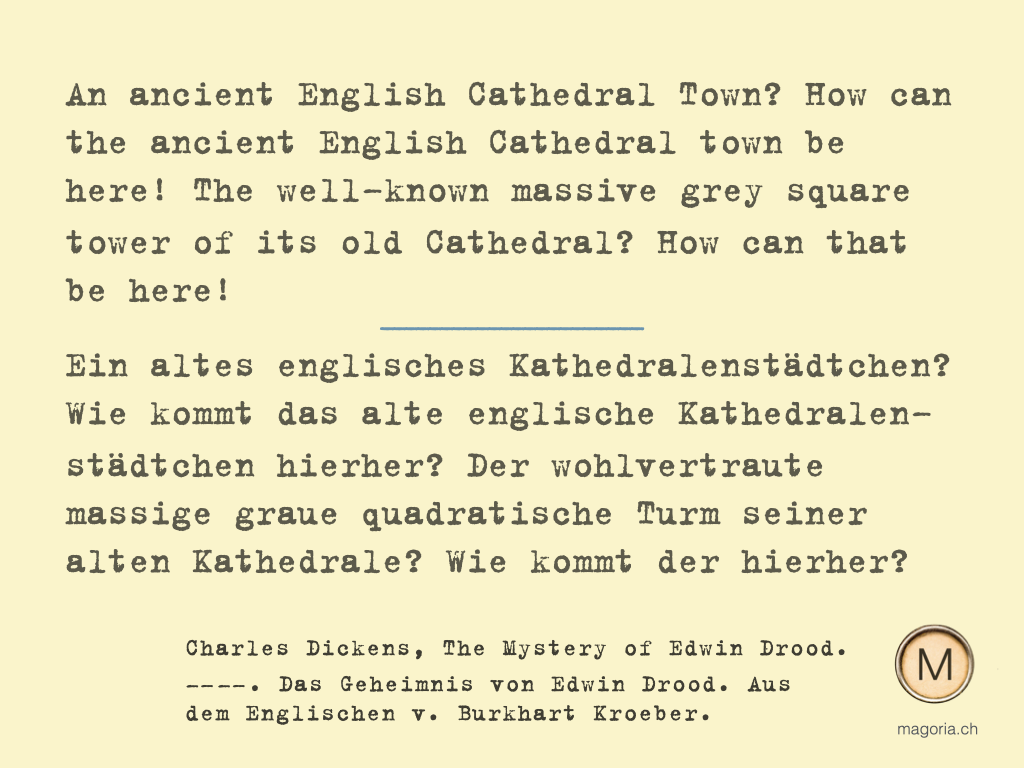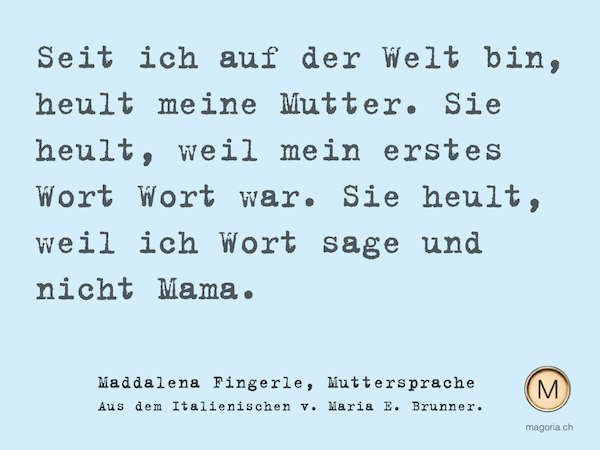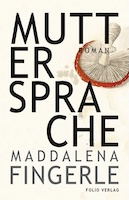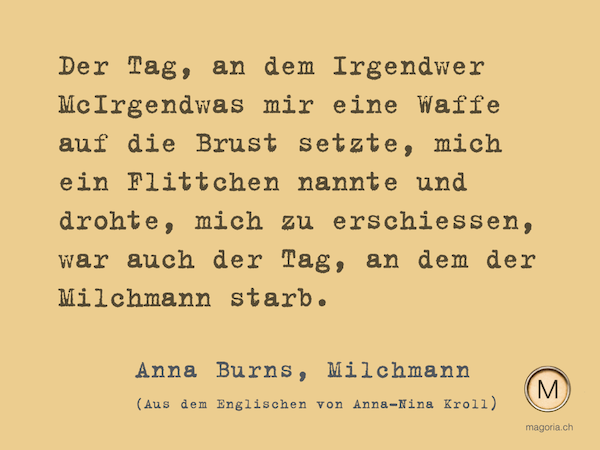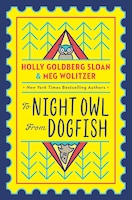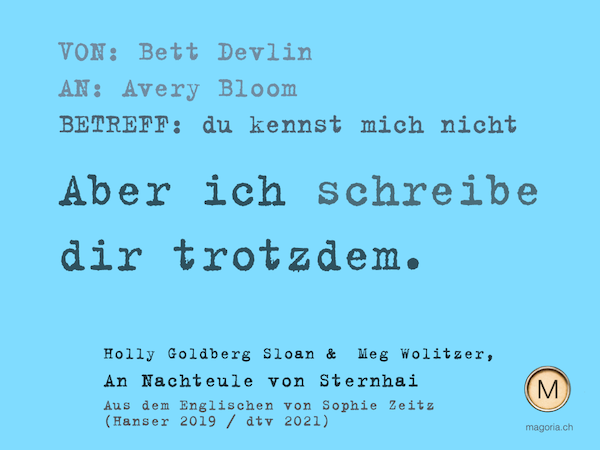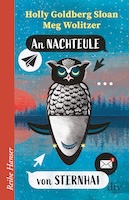Es ist Freundschaft auf den ersten Blick. Auf einem Sommerausflug mit ihrer Familie verirrt sich die elfjährige Elk in einem Heckenlabyrinth und wird von der furchtlosen Mab gerettet. Im Herbst finden sich die beiden unverhofft in der gleichen Klasse wieder und sind fortan unzertrenntlich. Das ist das Davor, an das sich Elk fünf Jahre später erinnert. Ihre demenzkranke Oma, zu der sie ein besonders inniges Verhältnis hatte und die sie mit dem Firmament und Quantenphysik bekannt machte, ist inzwischen gestorben. Auf Drängen der Eltern beginnt Elk eine Gesprächstherapie. Halt findet sie bei Mab und deren Bruder, zu dem sie sich mehr und mehr hingezogen fühlt.
Dann reisst etwas ihre Welt endgültig entzwei. Auf dem Heimweg nach einer Party kommt es zu einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht. Davor und Danach liegen nur einen Wimpernschlag auseinander, aber der verhängnisvolle Augenblick weitet sich zur unüberwindlichen Kluft. Bruchstückhaft kehren die Erinnerungen zurück. Elk erzählt, mit ihrer Freundin als geisterhafte Erscheinung an ihrer Seite.
Jenny Valentine macht es ihren Figuren und uns Leser:innen nicht einfach. Aber bis zum unvorhersehbaren Ende gelingt es ihr auf wundersame Weise, der Schwere von Verlust und Trauer etwas entgegenzusetzen. So handelt die Geschichte nicht nur von der Unerbittlichkeit des Todes, sondern mehr noch davon, wie intensive Begegnungen und gemeinsame Erfahrungen unser Leben prägen und bereichern. Die Autorin und ihr Übersetzer Klaus Fritz finden hierfür den passenden Ton und schaffen mit einer pulsierenden Sprache, eindrucksvollen Bildern und feinem Humor eine Brücke zwischen Glück und Kummer.
Daniel Ammann, 27.11.2025
Buch & Maus 3 (2025): S. 40.![]() sikjm.ch/rezensionen
sikjm.ch/rezensionen
Jenny Valentine
Zwei Seiten eines Augenblicks.
Aus dem Englischen von Klaus Fritz.
München: dtv, 2025. 185 Seiten. Lesealter ab 14.