
Der erste Satz, so wird gelegentlich behauptet – und manchmal trifft es wohl zu –, trägt bereits die ganze Geschichte, zumindest ihre DNA, in sich. Gleich einem Samenkorn, aus dem ein ganzer Baum wächst, den man vielleicht zu Papier verarbeitet, um das Buch herzustellen, das im ersten Satz wieder das Samenkorn enthält.
So viel darf man in Wackelkontakt dem ersten Satz zugestehen: Ein paar wichtige Dinge kommen schon vor, auch wenn man dies selbstredend erst erkennt, wenn man das Übrige gelesen hat. Das gilt in diesem Fall auch für die raffinierte Metalepse1.
Der erste Satz nimmt, wie so oft, vieles vorweg und verrät doch nichts. Das macht seinen Reiz aus und lässt mich so gern dahin zurückkehren, wo alles, wenigstens in einem Buch, beginnt. Hier haben wir: (1) Franz Escher, mit seinem allusiven Namen, (2) das Warten, das man mit einem Buch oder eben mit einem (3) Puzzle zubringen kann – bis einem das Schicksal ereilt oder in der Erwartung, dass sich irgendwann etwas (4) Erwartetes oder Unerwartetes ereignet. Die zusammengesetzten Puzzleteile greifen ineinander, vervollständigen ein Bild, das aber weiterhin aus einzelnen Stücken besteht und dessen Rahmen darüber hinwegtäuscht, dass es nur einen Ausschnitt zeigt. Als würden wir durch ein Fenster blicken.

Er verstand nicht, was hier abging. Was lief hier eigentlich? Das Bild setzte sich nicht zusammen. Er hatte einen Mangel an Informationen. Er hatte ein Zuviel an Informationen. Eine unendliche Leere öffnete sich unter seinen Füssen.
Machen wir es doch wie die Puzzlespieler und beginnen oben links mit dem Rahmen, dem ersten Satz.
Daniel Ammann 24.1.2025
- Auch bei der Metalepse handelt es sich um eine Art Wackelkontakt, einen narrativen Kurzschluss, bei dem unvermittelt die Ebene gewechselt wird. Wenn die einzelnen Erzählstränge ineinander greifen, sich Binnen- und Rahmenerzählung wider alle Logik gegenseitig enthalten und uns durch den Blick ins Bodenlose in einen Taumel stürzen, haben wir es mit einem Spezialfall der Metalepse zu tun, der sogenannten mise en abyme. ↩︎
Zum Thema «narrative Metalepse» siehe auch:



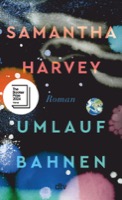



 Für seine erzählerische Kühnheit und die virtuose Gestaltung der Zeitumkehrung gebührt Martin Amis der vierte
Für seine erzählerische Kühnheit und die virtuose Gestaltung der Zeitumkehrung gebührt Martin Amis der vierte 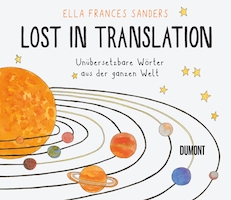


 Als die Autorin im Rahmen von
Als die Autorin im Rahmen von