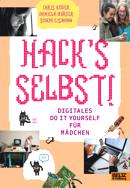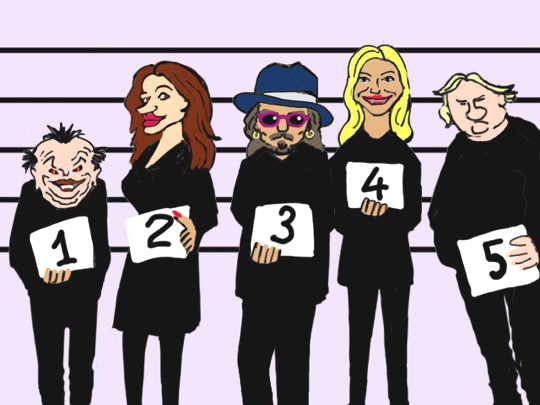Rezension.
ph akzente 1 (2011): S. 38.
![]() Download
Download
Thomas Steinfeld.
Der Sprachverführer. Die deutsche Sprache: was sie ist, was sie kann.
München: Hanser, 2010.
271 Seiten.
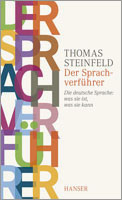
Rezension.
ph akzente 1 (2011): S. 38.
![]() Download
Download
Thomas Steinfeld.
Der Sprachverführer. Die deutsche Sprache: was sie ist, was sie kann.
München: Hanser, 2010.
271 Seiten.
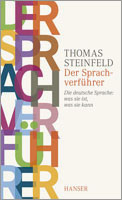
Rezension.
Buch & Maus 1 (2011): S. 31.
![]() SIKJM Rezensionsdatenbank
SIKJM Rezensionsdatenbank
![]() Download
Download
Kathrin Schrocke.
Freak City.
Mannheim: Sauerländer, 2010.
205 Seiten.
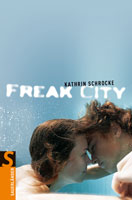
«Laura, Lars & Co.: Geschichten und Figuren in verschiedenen Medien.»
Trickfilm entdecken: Animationstechniken im Unterricht.
Hrsg. v. Daniel Ammann und Arnold Fröhlich.
Zürich: Verlag Pestalozzianum, 2008. S. 21–24.
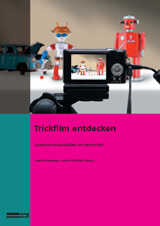
Die virtuellen Freunde der Kinder sind oft gleichzeitig in ganz unterschiedlichen Medien verfügbar. Bei der Lancierung eines neuen Produkts spielen Strategien der Vermarktung eine wichtige Rolle. Ein literarischer Stoff wird zum Beispiel als Spielfilm oder TV-Serie umgesetzt, als Hörbuch oder Hörspiel auf verschiedenen Tonträgern produziert und kommt als interaktives Computerspiel auf CD-ROM auf den Markt. Ergänzt werden diese Angebote durch eine breite Palette von Merchandising-Artikeln.
Die Beschäftigung mit beliebten Medienfiguren und Geschichten bietet im Unterricht Gelegenheit, der Faszinationskraft von Trickfilmen nachzugehen sowie Grenzen und Möglichkeiten unterschiedlicher medialer Darbietungsformen zu erkennen.
«Schreiben lehren.»
Akzente 3 (25.8.2017): Online-Ausgabe.
![]() blog.phzh.ch/akzente/2017/08/25/schreiben-lehren/
blog.phzh.ch/akzente/2017/08/25/schreiben-lehren/
![]() Download
Download
Swantje Lahm
Schreiben in der Lehre: Handwerkszeug für Lehrende.
Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2016. 190 Seiten.

«Hacken statt Häkeln: Ideen für technische Basteleien rund um Computer und Internet.»
NZZ am Sonntag 29.11.2015, Literaturbeilage ![]() «Bücher am Sonntag», S. 15.
«Bücher am Sonntag», S. 15.
Chris Köver, Daniela Burger u. Sonja Eismann.
Hack’s selbst! Digitales Do it yourself für Mädchen.
Weinheim: Beltz & Gelberg, 2015. 144 Seiten. Ab 13 Jahren.