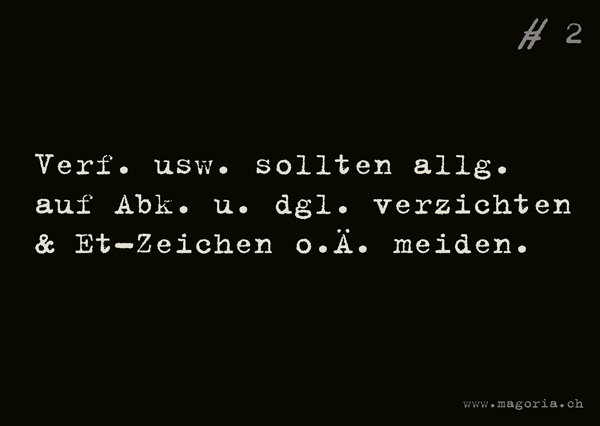«Spielt es eine Rolle, ob ein Wort Rock oder Hose trägt?»
 Typografische Verrenkungen machen die Welt nicht gerechter. Bei Lehrer*innen und Freund_innen werden die flexionslosen Männer sogar unterschlagen. Selbst Doppelnennungen sind nicht neutral, denn semantische Oppositionen unterstreichen den Gegensatz und schliessen alles aus, was dazwischenliegt. Als Sprachmonarch·in würde ich verfügen, dass wir uns wenigstens die Pluralformen teilen. Obgleich sie weiblich sind, wie ihre Pronomen zeigen. Zudem ist es diskriminierend, wenn weibliche Endungen nur an männliche angekoppelt werden. Das ist mehr Geschlecht als gerecht. Wer möchte denn Anhängsel sein?
Typografische Verrenkungen machen die Welt nicht gerechter. Bei Lehrer*innen und Freund_innen werden die flexionslosen Männer sogar unterschlagen. Selbst Doppelnennungen sind nicht neutral, denn semantische Oppositionen unterstreichen den Gegensatz und schliessen alles aus, was dazwischenliegt. Als Sprachmonarch·in würde ich verfügen, dass wir uns wenigstens die Pluralformen teilen. Obgleich sie weiblich sind, wie ihre Pronomen zeigen. Zudem ist es diskriminierend, wenn weibliche Endungen nur an männliche angekoppelt werden. Das ist mehr Geschlecht als gerecht. Wer möchte denn Anhängsel sein?
Aber spielt es eine Rolle, ob ein Wort Rock oder Hose trägt? Nehmen wir uns an Hoheiten (f), Gästen (m) und Mitgliedern (n) ein Beispiel und benennen dann beide (und mehr) Geschlechter, wenn sich im Kopf auch Bilder einstellen. Beim Lehrerzimmer geht es ums Zimmer, beim Schülerbuch ums Buch. Oder sagen wir Bäuerinnen- und Bauernhof und lassen die Tiere selbstredend weg? Bei aller Silbenakrobatik zählen in Texten schliesslich Kürze und Klang. Konzentrieren wir uns nebst Sexus und Genus auf Gehalt, Gesinnung und Genuss.
Apropos Gleichbehandlung: Die Frau des Königs wird Königin tituliert. Der Gatte der Queen ist nur ein Prinz. Klingt nach ausgleichender Gerechtigkeit, aber der Grund ist ernüchternd: Ein König ist ranghöher als eine Königin. Wie es bei den Royals mit Lohngleichheit und Vaterschaftsurlaub aussieht, weiss ich hingegen nicht.
Daniel Ammann
Erschienen in: ph inside 1 (März 2018): S. 19.
Zum Download.