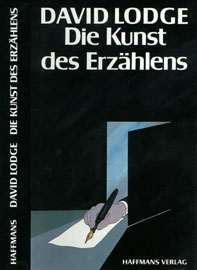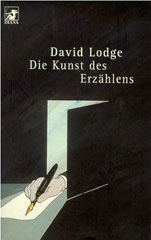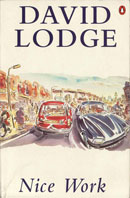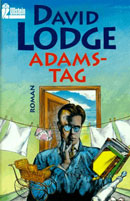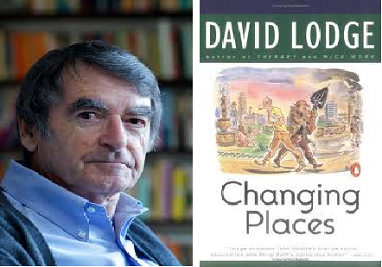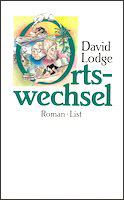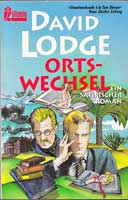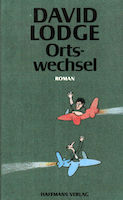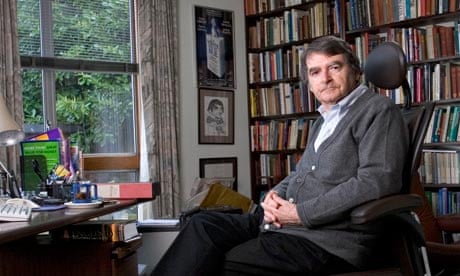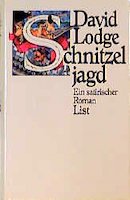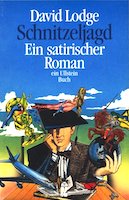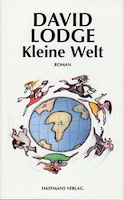David Lodge: Die Kunst des Erzählens.
Illustriert anhand von Beispielen aus klassischen und modernen Texten.
Aus dem Englischen von Daniel Ammann.
München u. Zürich: Diana (Heyne), 1998. 351 Seiten.
ISBN 3-453-15017-1.
(Gebundene Ausgabe: Zürich: Haffmans, 1993. 289 Seiten.
ISBN 3-251-00237-6)