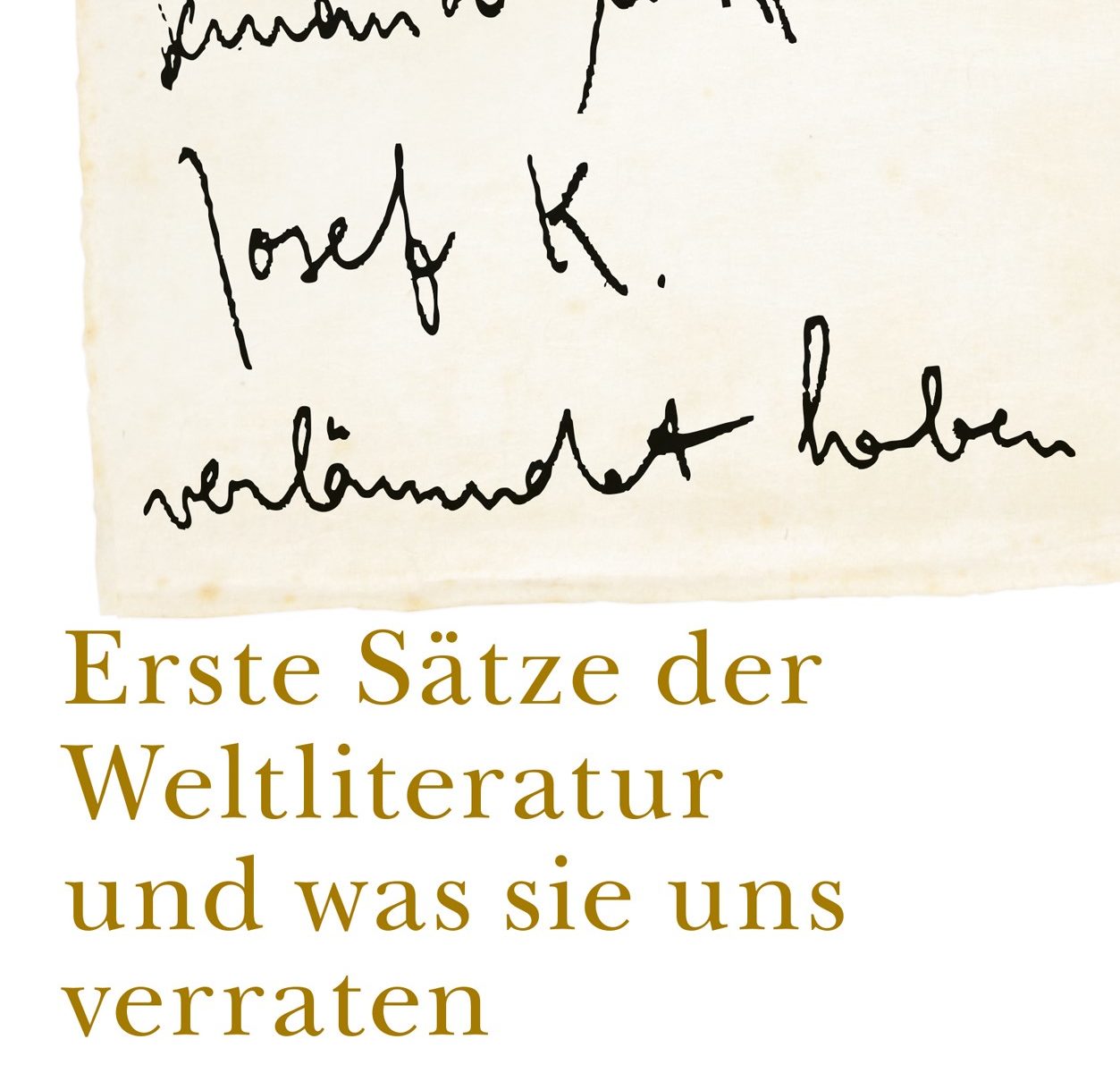«Es war einmal ein Anfang.»
Akzente 3 (27.8.2020).
![]() blog.phzh.ch/akzente/2020/08/27/es-war-einmal-ein-anfang/
blog.phzh.ch/akzente/2020/08/27/es-war-einmal-ein-anfang/
![]() Download
Download
Peter-André Alt
«Jemand musste Josef K. verleumdet haben …»: Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten.
München: C.H. Beck, 2020. 262 Seiten.

Siehe auch «Alles auf Anfang – eine kleine Poetik der ersten Sätze»