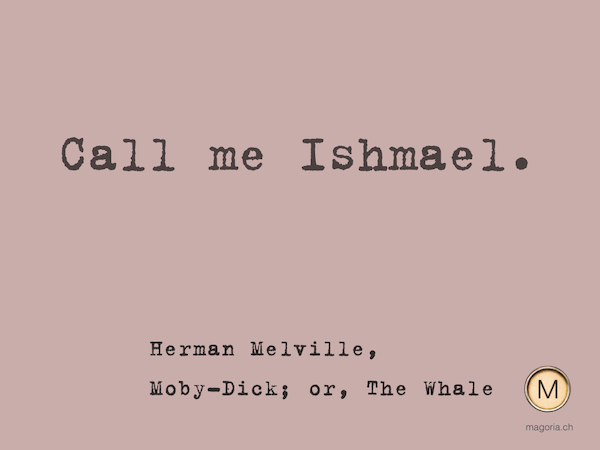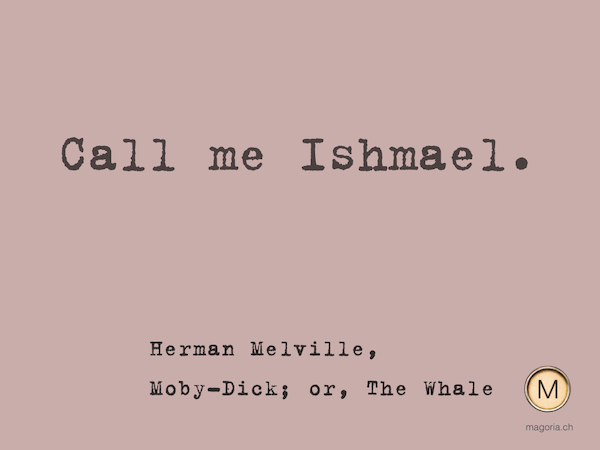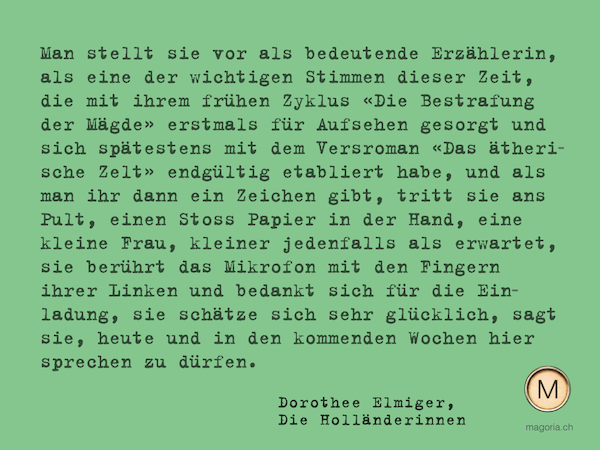
Der erste Satz lässt es erahnen: Hier wird keine konventionelle Geschichte, sondern vielmehr um zwei und mehr Ecken herum erzählt. Dorothee Elmiger gibt zu, dass dies Ausdruck ihrer grundsätzlichen Skepsis gegenüber dem Erzählen sei. Man kann sich der Verführungskunst des Erzählens durchaus mit zwielichtigen Konjunktiv entgegenstemmen. Im gleichen Zug jedoch verabreicht uns die Autorin auf subtile Weise einen Text, der eine fiktive Schriftstellerin in einem Hörsaal auftreten und vor Publikum sprechen lässt. Was diese erzählt, erfahren wir in indirekter Rede, aber ihre physische Gegenwart wird im Indikativ (in der Grammatik auch Wirklichkeitsform genannt) leibhaftig heraufbeschworen. 116 mal ‹sagt› sie, 14 mal ‹blättert› sie, 6 mal ‹schaut› sie, 5 mal ‹trinkt› sie, 4 mal ‹hebt› sie den Blick, 3 mal ‹nimmt› sie die Lesebrille, 2 mal ‹bedankt› sie sich. Sie greift zum bereitgestellten Wasserglas, räuspert sich, lächelt, verlagert ihr Gewicht, streicht sich mit den Fingern über die Nasenwurzel.

Deshalb gehe ich der Erzählskepsis der Autorin nicht vollends auf den Leim. Selbstverständlich verwehrt oder verstellt sie uns durch die erzählende Schriftstellerin am Rednerpult den direkten Blick auf die Geschehnisse. Aber ebenso steht diese Figur für konkrete Augenzeugenschaft. Sie berichtet. Sie war dabei. Eine andere Quelle gibt es nicht – abgesehen vom tatsächlichen Verschwinden zweier Holländerinnen im Dschungel ausserhalb des Textes.
Dieses doppelbödige Erzählen mit kaleidoskopartigen Perspektivenwechseln und das narrative Spiel mit Rahmung, Rückschau und Rekonstruktion eines versuchten Reenactments erinnern mich an Joseph Conrad, dessen Herz der Finsternis diesen Roman wohl in mehrfacher Hinsicht mit beeinflusst hat.
Daniel Ammann, 4.10.2025