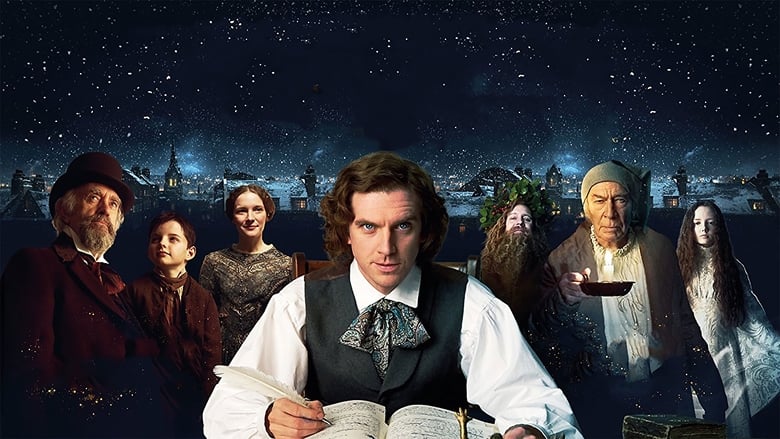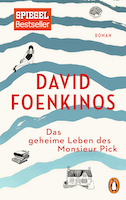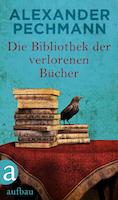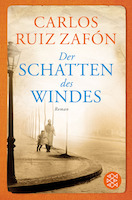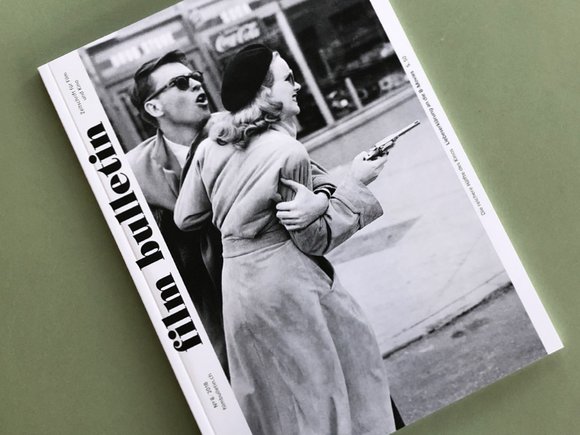«Die beste Idee kommt in der Badewanne.»
Neue Zürcher Zeitung 6.2.2021, S. 37.
![]() nzz.ch/feuilleton/
nzz.ch/feuilleton/
Woher nehmen Schriftsteller:innen eigentlich ihre Einfälle? Die Antwort erstaunt – und ist zugleich fast banal: Das Neue geht aus dem Alten hervor, indem wir Vertrautes variieren, umkrempeln oder auf ungewohnte Weise mit anderem kombinieren.