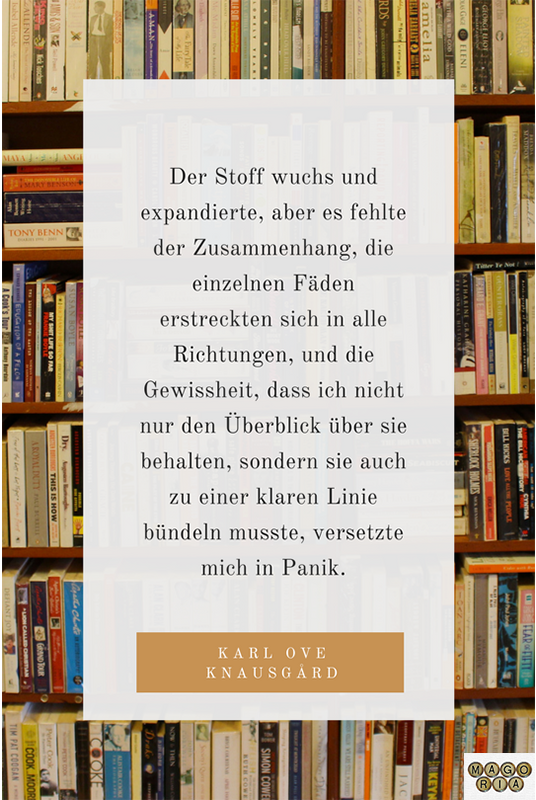
In Träumen, dem fünften Band seines autobiografischen Grossprojekts, berichtet der norwegische Schriftsteller Karl Ove Knausgård von seiner Zeit in Bergen und wie er dort nach dem Besuch der Akademie für Schreibkunst immer wieder im Schreiben scheitert, dann anfängt Literaturwissenschaft zu studieren, wieder aufgibt und doch unbeirrt von einer Karriere als Schriftsteller weiterträumt. Das Verfassen von Essays, Literaturkritiken und Seminararbeiten scheint ihm dabei einfacher von der Hand zu gehen:
Beim Verfassen von Hausarbeiten lief alles darauf hinaus, möglichst zu verbergen, was man nicht wusste. Dazu diente eine bestimmte Sprache, eine bestimmte Technik, und ich beherrschte sie. Zwischen den Dingen gab es Abgründe, die diese Sprache verdecken konnte, wenn man erst einmal gelernt hatte, wie es funktionierte.
Aber diese Selbstsicherheit hält nicht an. Als ihm bei einer späteren Hausarbeit nur noch wenige Wochen bis zum Abgabetermin bleiben, hat er erst wenige Seiten verfasst.
Schlimmer war jedoch, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich vorgehen sollte. Der Stoff wuchs und expandierte, aber es fehlte der Zusammenhang, die einzelnen Fäden erstreckten sich in alle Richtungen, und die Gewissheit, dass ich nicht nur den Überblick über sie behalten, sondern sie auch zu einer klaren Linie bündeln musste, versetzte mich in Panik.
Der Schreibforscher Hanspeter Ortner spricht in diesem Zusammenhang von embarras de richesse, also einer «Verwirrung durch Überfülle» (Ortner, Schreiben und Denken). Die kognitive Überlast blockiert den Schreibprozess ebenso wie die sprichwörtliche Angst vor dem leeren Blatt. Aber ihr ist vermutlich leichter beizukommen. Denn wer nichts zu sagen hat und unter einem Mangel an Material leidet, muss sich erst auf die Suche machen: lesen, recherchieren, Hypothesen entwickeln, Ideen generieren. Wer hingegen über zu viel Material verfügt, muss lediglich auswählen und eingrenzen. – Wenn das so einfach wäre!




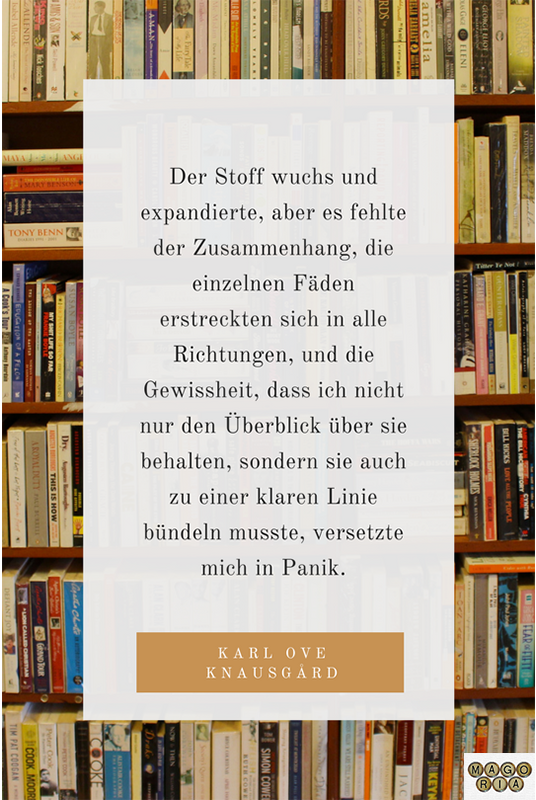


 Heute kann man sich Programme wie «
Heute kann man sich Programme wie «