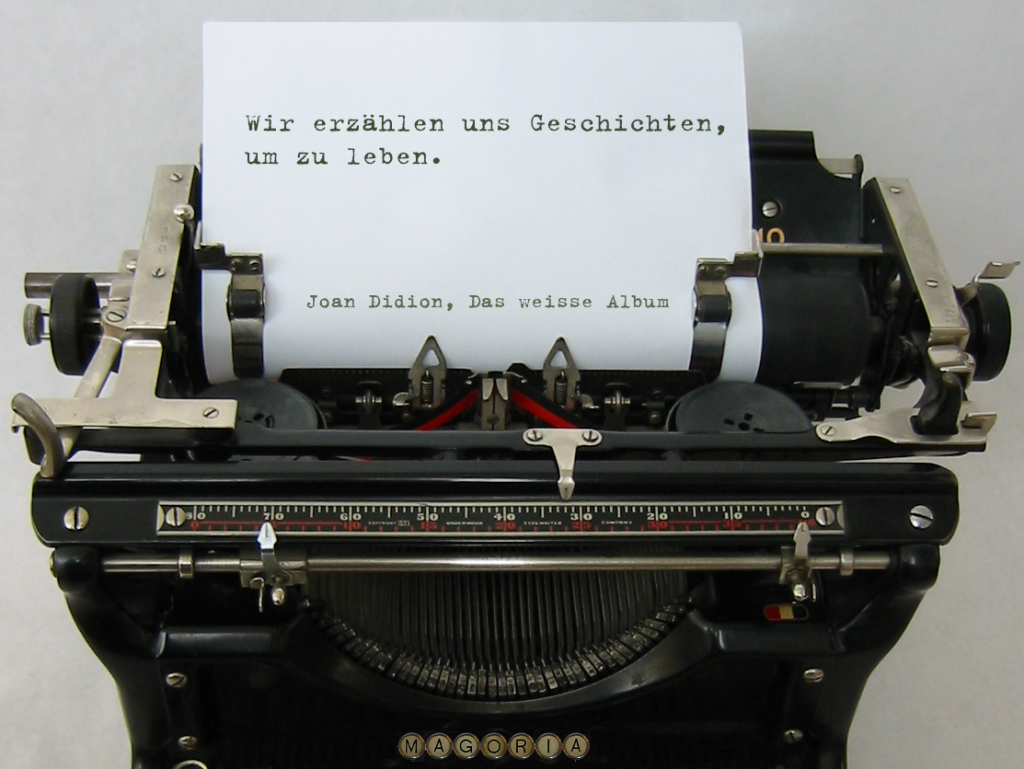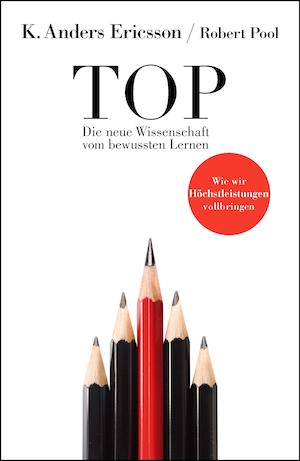Wenn wir uns auf einen Operationstisch legen oder in ein Flugzeug steigen, vertrauen wir uns lieber einer Chirurgin oder einem Piloten mit viel Erfahrung an. Übung macht schliesslich den Meister und die Meisterin. Darauf verlassen wir uns. Wie die Expertiseforschung allerdings zeigt, lässt sich Meisterschaft nicht einfach in Übungsstunden und Berufsjahren messen. Und auch das Talent wird überbewertet.
Der erste Satz …
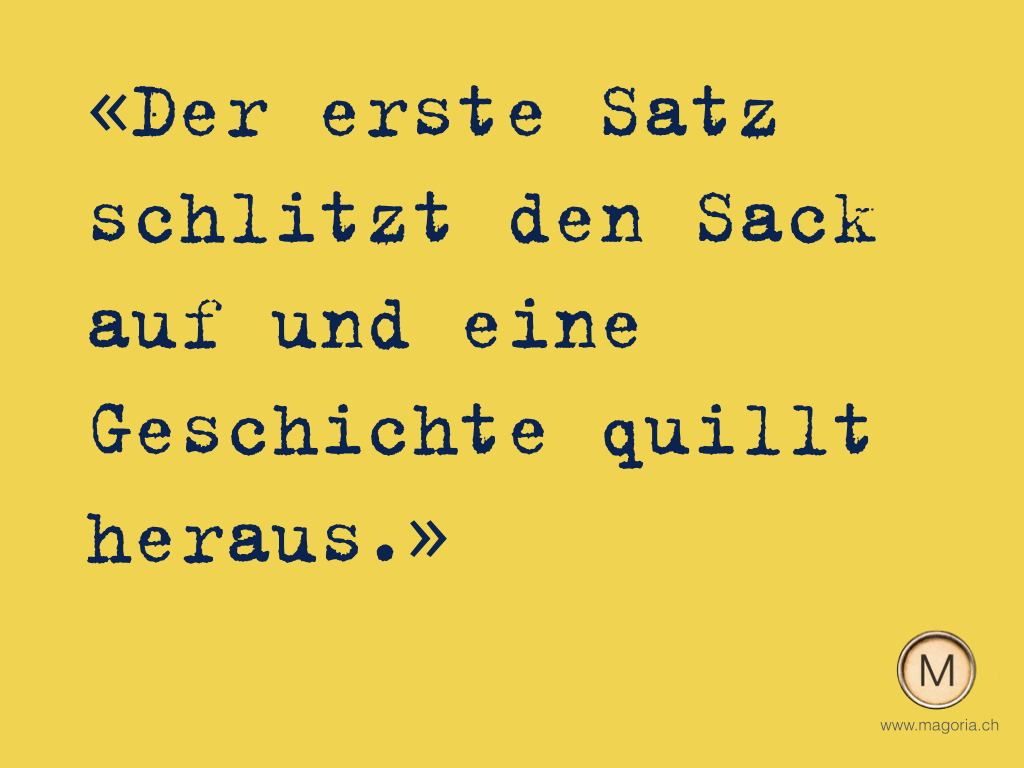
Mehr über erste Sätze und was sie mit uns und ihren Autorinnen und Autoren anrichten in meinem Beitrag «Alles auf Anfang – eine kleine Poetik der ersten Sätze» (NZZ 3.7.2019, S. 36.
Das perfekte Buch
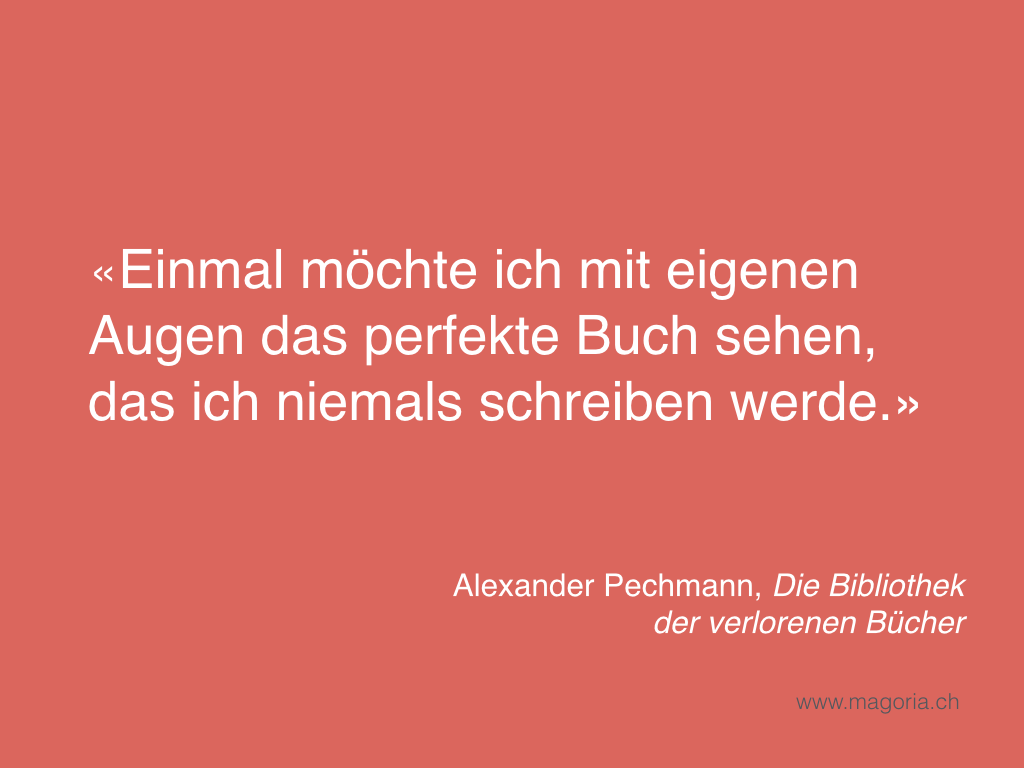
Kritik als Kunst
«Wer hat je innegehalten, um die Form oder den Tonfall einer Rezension oder eines kritischen Essays zu bewundern?» Die Frage des New Yorker Filmkritikers Anthony Scott ist berechtigt. Besprechungen von Filmen, Büchern, Theateraufführungen, Konzerten oder Ausstellungen werden als Orientierungshilfe geschätzt, beeinflussen als Verriss oder Lobeshymne vielleicht den Erfolg eines Werks. Aber als eigene Kunstform, wie das schon der berühmte Kritiker und Journalist Alfred Kerr (1867–1948) gefordert hat, wird die Kritik kaum gewürdigt.
Dazu passt auch Ernest Hemingways Bemerkung in A Moveable Feast, als er einem Freund den Rat gibt: «Pass auf, wenn du nicht schreiben kannst – wie wär’s, wenn du’s mal mit Rezensionen versuchen würdest? […] Dann hast du immer was zu schreiben. Du brauchst dir nie mehr Sorgen zu machen, dass nichts mehr kommt, dass du stumm und still geworden bist. Und du hast Leser und Anerkennung.»
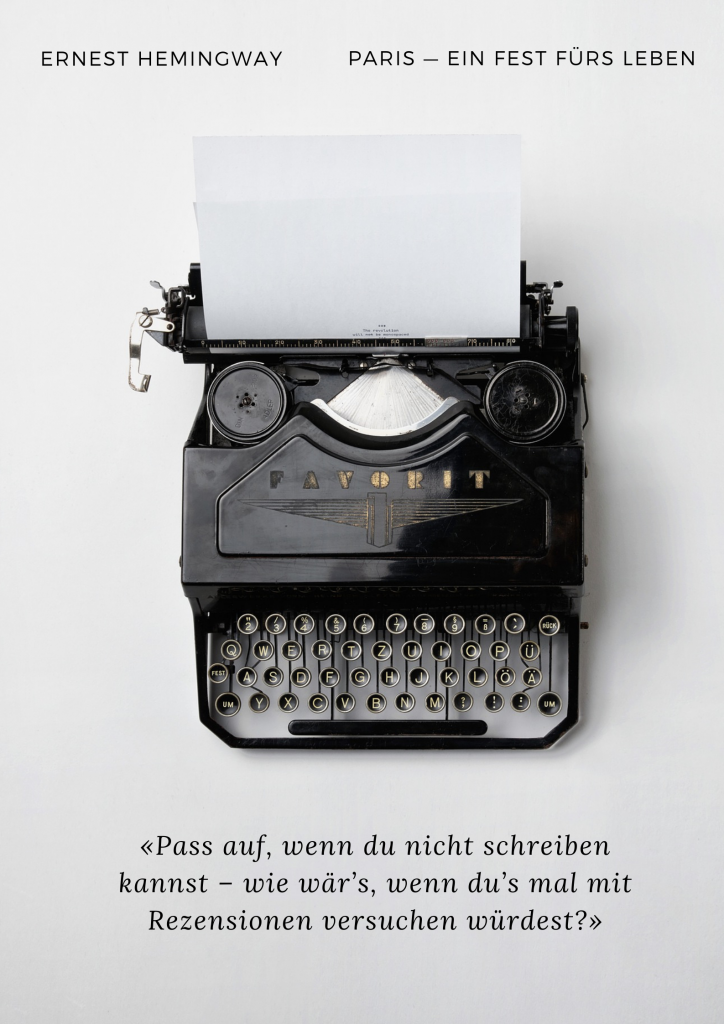
Noch immer haftet der Kritik das Image der Unkreativität an. Ohne all die kreativen Beiträge, heisst es gerne, hätten die Kritikerinnen und Kritiker gar nichts, worüber sie schreiben könnten. Ausserdem, so Scott, bedeutet kritisieren für viele, «dass man etwas auszusetzen hat, dass man das Negative betont, den Spass verdirbt und sich weigert, auf empfindliche Gefühle Rücksicht zu nehmen.» Dabei sollte man sich für die Kritik durchaus stark machen, wie das in diesem anregenden und aufschlussreichen Buch geschieht. Im Zeitalter der Meinungsmache und Gefällt-mir-Klicks geht gern vergessen, dass Kritik nicht nur Stellung bezieht, sondern Massstäbe anlegt, ohne die ein begründetes Urteil gar nicht möglich ist. Kritik schärft die Wahrnehmung und ebnet den Weg für einen Diskurs.
In seinen Ausführungen und ironischen Selbstgesprächen schüttet Anthony Scott nicht nur sein Herz aus, sondern zeigt auf, welch wichtige Rolle die Kritik seit Jahrhunderten spielt. Viele bedeutende Kritiker, wie die Kulturgeschichte belegt, waren selbst Künstler und umgekehrt. Charles Baudelaire schrieb über moderne Malerei, der Lyriker Philip Larkin über Jazz. Auch Regisseure wie Godard, Chabrol oder Truffaut haben als Filmkritiker angefangen. Das mögen Ausnahmeerscheinungen sein, wie Scott eingesteht, aber in erster Linie sei die Kritik eine «Disziplin des Schreibens» und der Kritiker «eine besondere Spezies der Gattung Schriftsteller». Etwas heruntermachen, bemängeln und anfeinden ist keine Kunst, gute Kritik jedoch erfordert Argumente, klare Begriffe und vor allem Unterscheidungsmerkmale, sprich: Kriterien. Über Geschmack lässt sich nicht streiten – über Kritik schon.
Daniel Ammann, 23.2.2018
«Über Kritik lässt sich streiten.»
Akzente 1 (23.2.2018).
doi.org/10.5281/zenodo.1250755![]() blog.phzh.ch/akzente/2018/02/23/ueber-kritik-laesst-sich-streiten/
blog.phzh.ch/akzente/2018/02/23/ueber-kritik-laesst-sich-streiten/![]() Download
Download
Anthony O. Scott
Kritik üben: Die Kunst des feinen Urteils.
Aus dem Englischen von Martin Pfeiffer.
München: Carl Hanser, 2017. 320 Seiten.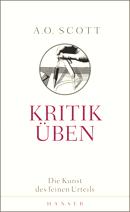
Schreibzitat #4: Doris Dörrie
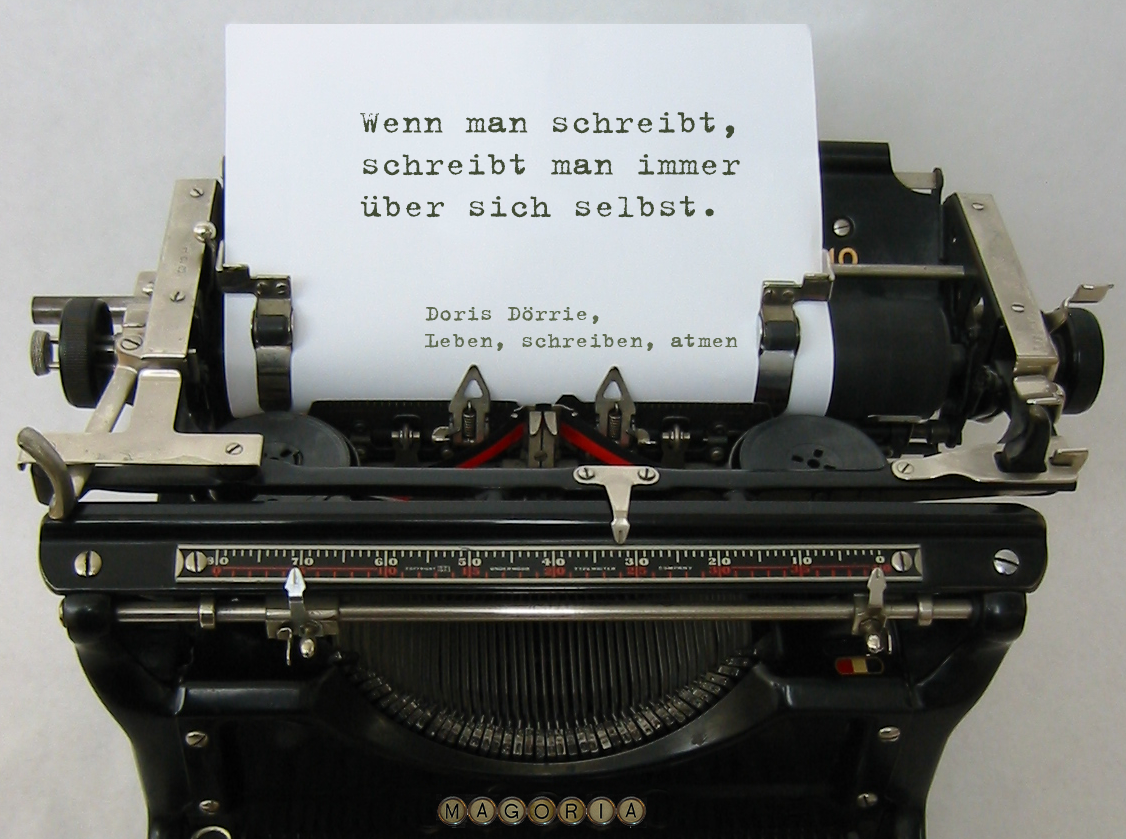
Schreibzitat #3: Joan Didion