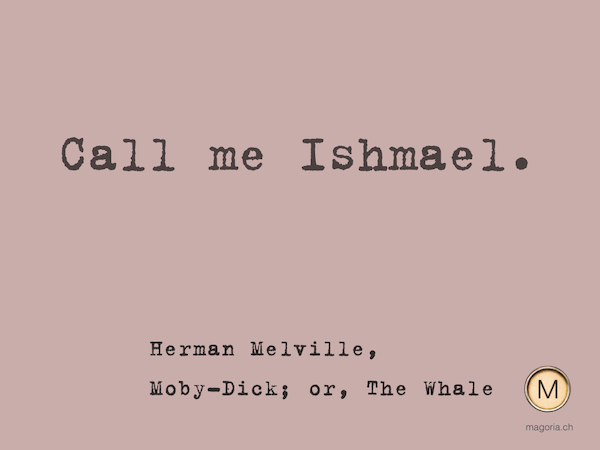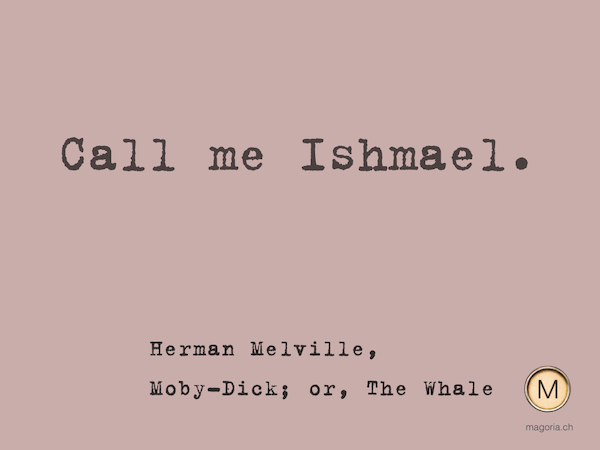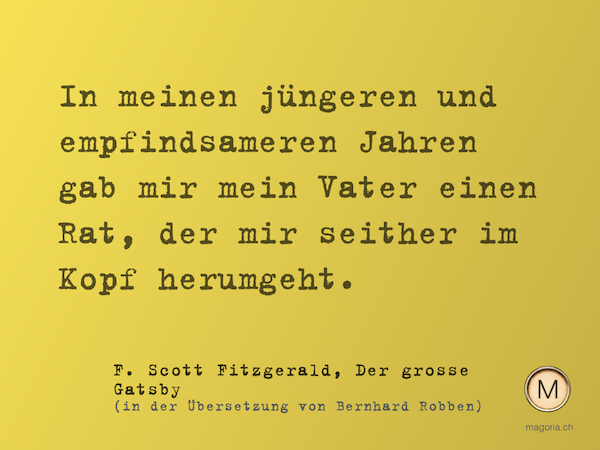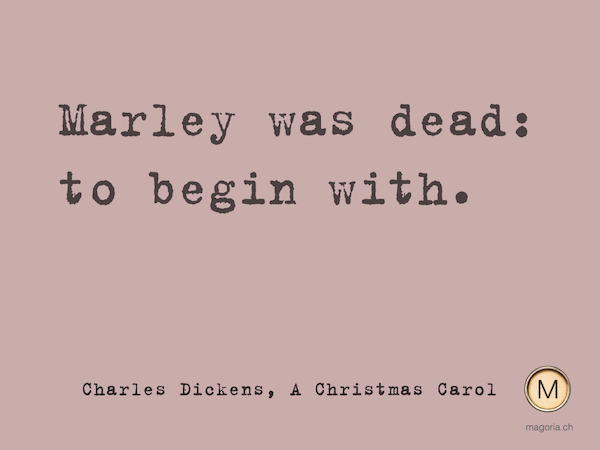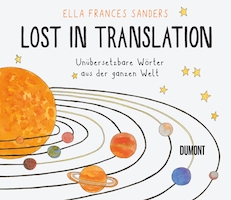Vor ein paar Jahren, vermutlich 2018, spielte ich mit dem Gedanken, Herman Melvilles Meistererzählung «Bartley, the Scrivener» ins Deutsche zu übertragen. Nicht als Erster natürlich, aber es wäre ein gute Übung, um literatur- und sprachwissenschaftlich in Schwung zu bleiben. Man liest ja nie genauer, als wenn man einen Text Satz für Satz in eine andere Sprache transportiert. Bekanntlich geht es dabei nicht nur um die inhaltliche Fuhre semantische Präzision und ein zeitgemässes Register. Man möchte vor allem die passende Atmosphäre schaffen, den Ton zu treffen und dem Stil des Ausgangstextes gerecht werden. Also ein waghalsiges Spiel, bei dem es sprachlich und literarisch zur Sache und dem Übersetzer oder der Übersetzerin an den Kragen geht, sollte das Unterfangen missglücken. 1
Aus ebendiesen Gründen macht es aber auch unendlichen Spass, über linguistische Feinheiten und kalauernde Grobheiten nachzudenken und mit Gleichgesinnten zu diskutieren, wie wir das monatlich am Zürcher Übersetzer:innen-Treffem unter Ulrich Blumenbachs Leitung in der James-Joyce-Stifung praktizieren . Manchmal fördert das Schwarmdenken überraschend eine mehrheitsfähige Lösung zutage, dann wieder verzetteln wir uns gehörig und kommen zu keiner Einigung. Die Übersetzer:innen, die eine Knacknuss mitgebracht haben, gehen mit nützlichen Anregungen nach Hause, auch wenn die seligmachende Variante oft noch nicht gefunden ist. Fast schlimmer: Sie müssen sich für eine von mehreren genialen Lösungen entscheiden – und das Feuilleton urteilt dann selbstgerecht, sie seien zu weit oder doch nicht weit genug gegangen, hätten sich falsch entschieden, zu viel Mut oder zu wenig Experise bewiesen. Da mag der eine oder die andere sich die Haare raufen und wünschen, man hätte den Auftrag erst gar nicht bekommen oder ihn mit Bartebys Worten ausgeschlagen.2
Ich möchte lieber nicht.
Herman Melvilles Meistererzählung «Bartleby, the Scrivener» wurde bereits über ein dutzend mal ins Deutsche übersetzt – als «Bartleby», «Der Schreiber Bartleby», «Bartleby, der Schreibgehilfe», «Bartleby der Lohnschreiber», meistens jedoch unter dem Titel «Bartley, der Schreiber».
Auch der erste Satz – «I am a rather elderly man» – zeigt wieder einmal, wie viele Varianten möglich sind. Hier ein paar Kostproben, welchen Ton die bisherigen Übersetzungen anschlagen:
Ich bin nicht mehr der Jüngste.
Karl-Heinz Ott (Kampa 2025)
Ich bin nun schon ein älterer Mann.
Felix Mayer (Anaconda 2010)
Ich bin schon vorgerückten Alters.
Michael Walter u. Daniel Göske (Hanser 2009)
Ich bin ein schon recht bejahrter Mann.
Jürgen Krug (Insel 2004)
Ich bin ein schon etwas bejahrter Mann.
Elisabeth Schnack (Manesse 2002/Penguin 2022)
Ich bin ein Mann schon vorgerückten Alters.
Karlernst Ziem (1966/C.H. Beck 2011)
Ich bin bereits im gesetzteren Alter.
Richard Mummendey (1967/1984)
Ich bin, ich muss es gestehn, nicht mehr der Jüngste.
(Karl Lerbs, 1939/1946)
Als Erstes fällt vielleicht auf, dass die Erstübersetzung von Karl Lerbs sowie die jüngste Übertragung durch Karl-Heinz Ott sich für «nicht mehr der Jüngste» entscheiden. Das wäre auch mein Favorit gewesen. Die Formulierung trifft es idiomatisch, obgleich sie etwas frischer als Melvilles «rather elderly» klingt. Der Ich-Erzähler, der eine Anwaltskanzlei leitet, geht auf die sechzig zu und ist, wie er uns eingangs wissen lässt, seit über dreissig Jahren im Geschäft. Da hat er wohl schon viel gesehen und ist nicht leicht aus der Ruhe zu bringen. Aber – und was wäre das für eine Geschichte, wenn es kein Aber gäbe – trotz beruflicher Routine und reichlich Lebenserfahrung ist er nicht vor Überraschungen gefeit. Ein neuer Kopist, der allersonderbarste Schreiber, der dem Ich-Erzähler je begegnet ist, betritt die Bühne der Kanzlei. Mit mit seiner widerborstigen Sanftmut versetzt er die geordnete Welt des Notars in Aufruhr – und das, ohne auch nur einen Finger zu rühren.
Daniel Ammann, 1.5.2025
- Es gibt noch zwei private Gründe, warum diese Geschichte mir am Herzen liegt: Zum einen arbeite ich seit langem schon mit der Textverarbeitung Scrivener, zum anderen hat die Kanzleiatmosphäre des Melville-Klassikers und sein kauziger Antiheld für eine meiner eigenen Geschichten Pate gestanden und mich kreativ inspiriert. ↩︎
- «I would prefer not to.» – Auch dieser formelhafte Satz wird auf unterschiedliche Weise ins Deutsch gebracht:
«Ich möchte lieber nicht.» (Karl-Heinz Ott, Jürgen Krug, Karlernst Ziem, Elisabeth Schnack, Karl Lerbs)
«Es ist mir eigentlich nicht genehm.» (Michael Walter)
«Ich würde vorziehen, es nicht zu tun.» (Richard Mummendey)
«Eigentlich möchte ich nicht.» (Marianne Graefe). ↩︎

Herman Melville
Bartleby, der Schreiber. Eine Geschichte aus der Wall Street.
Aus dem amerikanischen Englisch und mit einem Essay von Karl-Heinz Ott.
Zürich: Kampa, 2025. 125 Seiten.