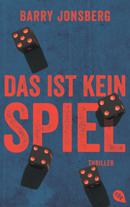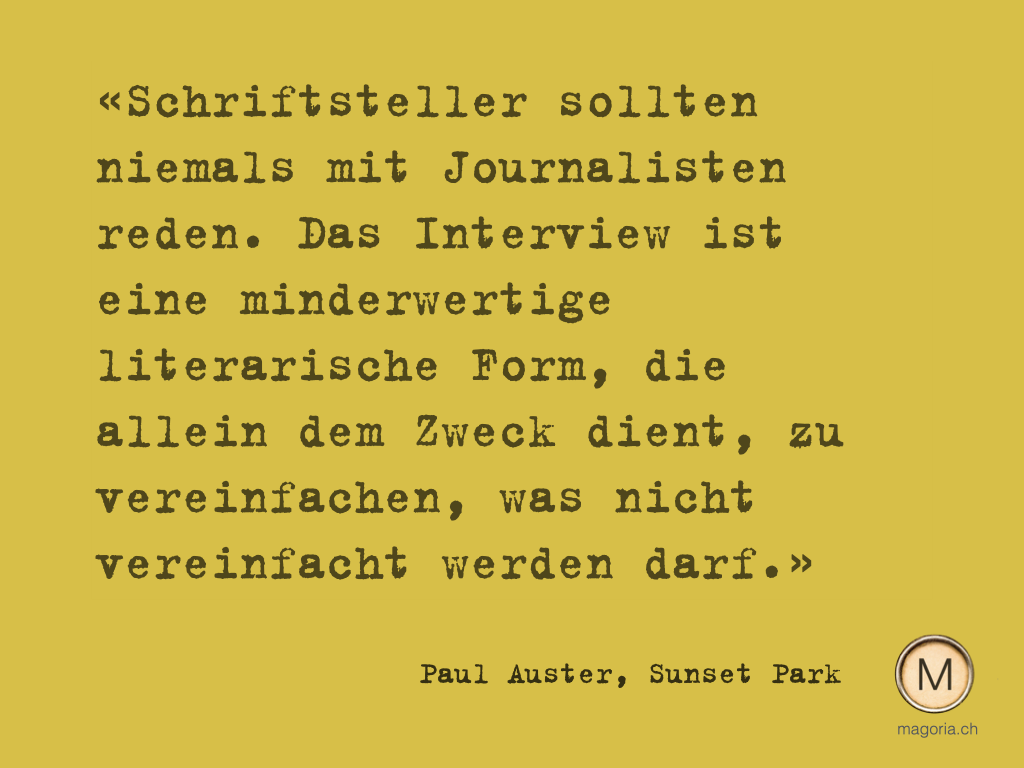
Kritik als Kunst
«Wer hat je innegehalten, um die Form oder den Tonfall einer Rezension oder eines kritischen Essays zu bewundern?» Die Frage des New Yorker Filmkritikers Anthony Scott ist berechtigt. Besprechungen von Filmen, Büchern, Theateraufführungen, Konzerten oder Ausstellungen werden als Orientierungshilfe geschätzt, beeinflussen als Verriss oder Lobeshymne vielleicht den Erfolg eines Werks. Aber als eigene Kunstform, wie das schon der berühmte Kritiker und Journalist Alfred Kerr (1867–1948) gefordert hat, wird die Kritik kaum gewürdigt.
Dazu passt auch Ernest Hemingways Bemerkung in A Moveable Feast, als er einem Freund den Rat gibt: «Pass auf, wenn du nicht schreiben kannst – wie wär’s, wenn du’s mal mit Rezensionen versuchen würdest? […] Dann hast du immer was zu schreiben. Du brauchst dir nie mehr Sorgen zu machen, dass nichts mehr kommt, dass du stumm und still geworden bist. Und du hast Leser und Anerkennung.»
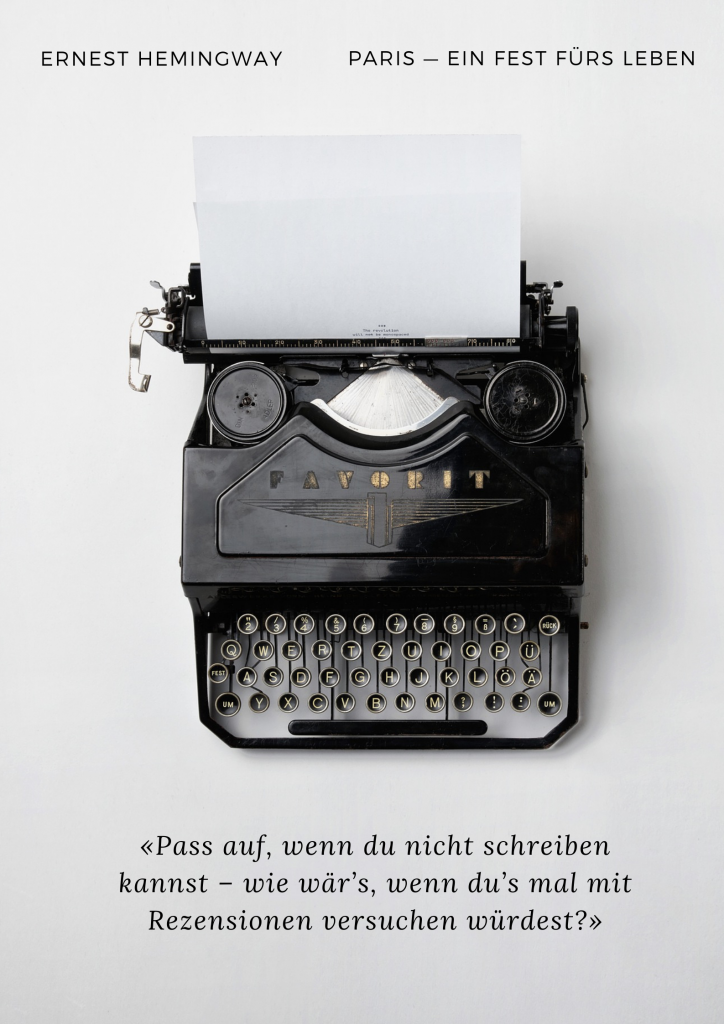
Noch immer haftet der Kritik das Image der Unkreativität an. Ohne all die kreativen Beiträge, heisst es gerne, hätten die Kritikerinnen und Kritiker gar nichts, worüber sie schreiben könnten. Ausserdem, so Scott, bedeutet kritisieren für viele, «dass man etwas auszusetzen hat, dass man das Negative betont, den Spass verdirbt und sich weigert, auf empfindliche Gefühle Rücksicht zu nehmen.» Dabei sollte man sich für die Kritik durchaus stark machen, wie das in diesem anregenden und aufschlussreichen Buch geschieht. Im Zeitalter der Meinungsmache und Gefällt-mir-Klicks geht gern vergessen, dass Kritik nicht nur Stellung bezieht, sondern Massstäbe anlegt, ohne die ein begründetes Urteil gar nicht möglich ist. Kritik schärft die Wahrnehmung und ebnet den Weg für einen Diskurs.
In seinen Ausführungen und ironischen Selbstgesprächen schüttet Anthony Scott nicht nur sein Herz aus, sondern zeigt auf, welch wichtige Rolle die Kritik seit Jahrhunderten spielt. Viele bedeutende Kritiker, wie die Kulturgeschichte belegt, waren selbst Künstler und umgekehrt. Charles Baudelaire schrieb über moderne Malerei, der Lyriker Philip Larkin über Jazz. Auch Regisseure wie Godard, Chabrol oder Truffaut haben als Filmkritiker angefangen. Das mögen Ausnahmeerscheinungen sein, wie Scott eingesteht, aber in erster Linie sei die Kritik eine «Disziplin des Schreibens» und der Kritiker «eine besondere Spezies der Gattung Schriftsteller». Etwas heruntermachen, bemängeln und anfeinden ist keine Kunst, gute Kritik jedoch erfordert Argumente, klare Begriffe und vor allem Unterscheidungsmerkmale, sprich: Kriterien. Über Geschmack lässt sich nicht streiten – über Kritik schon.
Daniel Ammann, 23.2.2018
«Über Kritik lässt sich streiten.»
Akzente 1 (23.2.2018).
doi.org/10.5281/zenodo.1250755![]() blog.phzh.ch/akzente/2018/02/23/ueber-kritik-laesst-sich-streiten/
blog.phzh.ch/akzente/2018/02/23/ueber-kritik-laesst-sich-streiten/![]() Download
Download
Anthony O. Scott
Kritik üben: Die Kunst des feinen Urteils.
Aus dem Englischen von Martin Pfeiffer.
München: Carl Hanser, 2017. 320 Seiten.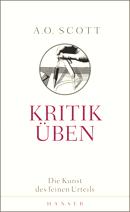
Wunderjahr 1922
«Wunderjahr.»
Akzente 3 (2023): S. 35.![]() blog.phzh.ch/akzente/2023/08/24/wunderjahr/
blog.phzh.ch/akzente/2023/08/24/wunderjahr/![]() Download
Download
1922 gilt als Annus mirabilis der Literatur. Der Ulysses von James Joyce und T. S. Eliots The Waste Land werden in einem Atemzug genannt. Innovativ, experimentell und in ihrer Vielstimmigkeit modern muten diese Titel heute noch an. So auch Mrs. Dalloway. Virginia Woolfs Roman erscheint zwar drei Jahre später, aber seine Entstehung fällt ebenfalls ins Jahr 1922. Dank der frischen Übersetzung von Melanie Walz darf dieses Meisterwerk nun wieder neu entdeckt werden (Manesse, 2022).
In seinem erzählenden Sachbuch 1922 (Luchterhand, 2022) nimmt Norbert Hummelt neben Joyce, Eliot und Woolf auch den damals im Wallis lebenden Dichter Rainer Maria Rilke in den Blick. In einem kalendarischen Kaleidoskop fügt Hummelt biografische Momentaufnahmen zu Mosaiken zusammen und lässt uns hautnah ins Wunderjahr der Worte eintauchen.
Wer hätte geahnt, dass sich 100 Jahre später noch ein Schweizer dazugesellt – kurz nachdem man die Zweihunderternote mit seinem Konterfei aus dem Verkehr gezogen hat. Sturz in die Sonne (Limmat, 2023) des Waadtländer Autors C. F. Ramuz erscheint jetzt erstmals auf Deutsch. Dass Ramuz damit den Klimaroman vorwegnehme, stimmt nur bedingt. Die apokalyptische Geschichte handelt eher von der in atavistische Aggression umschlagenden Apathie der Menschen im Angesicht des Todes. Durch einen Unfall im Gravitationssystem gerät die Erde aus ihrer Umlaufbahn und nimmt Kurs auf die Sonne.
– Daniel Ammann
Literaturangaben
Virginia Woolf
Mrs. Dalloway.
Aus dem Englischen übersetzt von Melanie Walz.
München: Manesse, 2022. 400 Seiten.

Norbert Hummelt
1922.
München: Luchterhand, 2022. 416 Seiten.
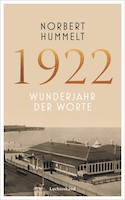
C. F. Ramuz
Sturz in die Sonne.
Übersetzt von Steven Wyss.
Zürich: Limmat, 2023. 192 Seiten.

Matthew Quick: Schildkrötenwege
Rezension
Buch & Maus 3 (2018): S. 36.
Matthew Quick.
Schildkrötenwege oder Wie ich beschloss, alles anders zu machen.
Aus dem amerikanischen Englisch von Knut Krüger.
München: dtv, 2018. 298 Seiten.
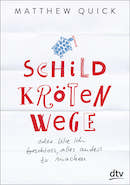
Estelle Laure: Während ich vom Leben träumte
Rezension
NZZ am Sonntag 24.6.2018, Literaturbeilage ![]() «Bücher am Sonntag», S. 12.
«Bücher am Sonntag», S. 12.
![]() Download
Download
Estelle Laure.
Während ich vom Leben träumte.
Aus dem Amerikanischen von Sophie Zeitz.
Frankfurt/M.: Fischer KJB, 2018. 299 Seiten. Ab 14 Jahren.
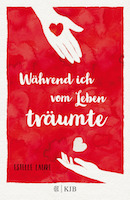
Barry Jonsberg: Das ist kein Spiel
Rezension
Buch & Maus 1 (2018): S. 34
![]() sikjm.ch/rezensionen
sikjm.ch/rezensionen
![]() Download
Download
Barry Jonsberg.
Das ist kein Spiel.
Aus dem Englischen von Ursula Höfker.
München: cbt, 2017. 319 Seiten.