Wenn es um die Mühsal des Schreibens geht, jammern selbst erfahrene Autoren auf hohem Niveau. Wie beschwerlich muss es erst sein, wenn man um jeden einzelnen Buchstaben ringt. Jean-Dominique Bauby erleidet mit 43 einen Hirnschlag und bleibt vollständig gelähmt. Wahrnehmung und Denken sind intakt, aber eingesperrt in seinem Körper kann er nicht mit der Aussenwelt kommunizieren. Ein Auge muss zugenäht werden, mit dem anderen kann er noch blinzeln. Mit Hilfe einer Alphabettabelle gelingt es Bauby, ein ganzes Buch zu diktieren. In Schmetterling und Taucherglocke beschreibt er seinen Zustand und blickt auf sein bisheriges Leben zurück. Regisseur Julian Schnabel hat Baubys Geschichte 2007 verfilmt und zeigt in starken Bildern, wie der Autor seine Ohnmacht überwindet und allen Widerständen zum Trotz und mit Humor erzählt.
Auch Stephen Hawking hat trotz seiner degenerativen Nervenerkrankung zahlreiche Bücher verfasst, wie im Biopic The Theory of Everything zu sehen ist. Als der junge Physiker im Rollstuhl sitzt und nicht mehr sprechen kann, ermöglicht ihm ein Computer, per Knopfdruck etwa vier Wörter pro Minute zu produzieren.
Weit grösser waren die Hindernisse für die Helen Keller (1880–1968), die seit ihrem zweiten Lebensjahr blind und gehörlos war. Nur dank ihrer engagierten Erzieherin und Hauslehrerin Annie Sullivan schaffte sie den Weg aus der Isolation und erlangte mit ihren Büchern Weltruhm. In seiner preisgekrönten Graphic Novel Sprechende Hände zeichnet Joseph Lambert Helens bewegende Geschichte nach und gibt Einblick in die einzigartige Beziehung zwischen Lehrerin und Schülerin.
Daniel Ammann, 23.2.2016
Erschienen in: Akzente 1 (2016): S. 35. (PDF)
Bauby, Jean-Dominique. Schmetterling und Taucherglocke. Deutsch v. Uli Aumüller. München: dtv, 2009 (1998). 134 Seiten.
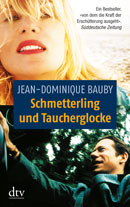
Le scaphandre et le papillon. (Schmetterling und Taucherglocke.) Frankreich/USA 2007. Regie: Julian Schnabel.
The Theory of Everything. (Die Entdeckung der Unendlichkeit: die aussergewöhnliche Geschichte von Jane und Stephen Hawking.) GB 2014. Regie: James Marsh. Zürich: Universal Pictures Switzerland, 2015. DVD.
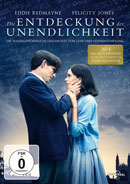
Lambert, Joseph. Sprechende Hände: Die Geschichte von Helen Keller. Aus dem Amerikanischen von Johanna Wais. Köln: Egmont Graphic Novel, 2015. 96 Seiten.
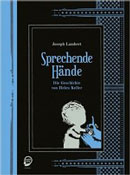


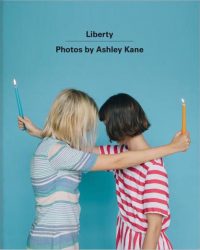
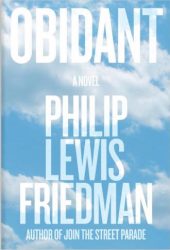
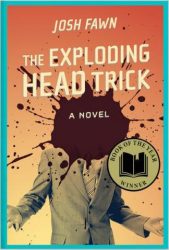
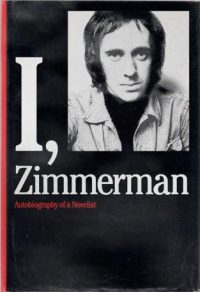
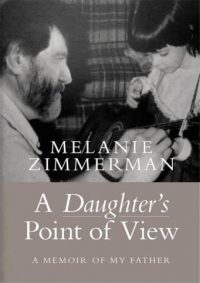


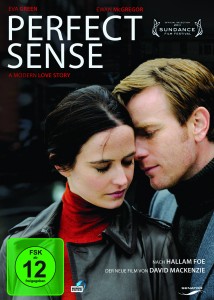 Unsere Sinne sind ein Tor zur Welt. Wenn sie ausfallen, entschwindet ein Stück Wirklichkeit.
Unsere Sinne sind ein Tor zur Welt. Wenn sie ausfallen, entschwindet ein Stück Wirklichkeit.

