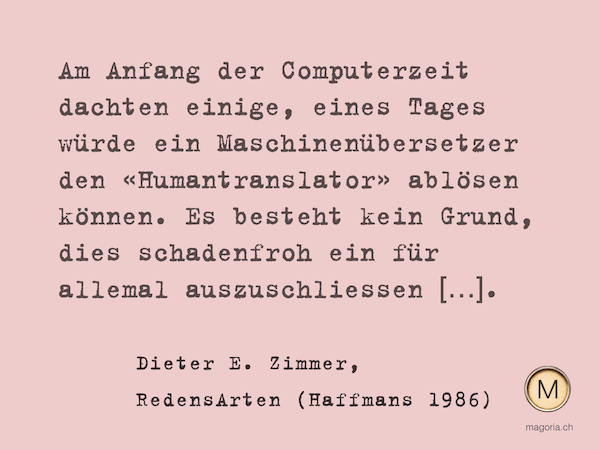
Vor gut vierzig Jahren machte sich Dieter E. Zimmer angesichts des angebrochenen Computerzeitalters bereits Gedanken über die Zukunft des literarischen Übersetzens. «In der Euphorie des Anfangs», schreibt er 1986, «hat man den Computer über- , weit mehr aber noch den menschlichen Geist unterschätzt». In der Taschenbuchausgabe resümiert er zwei Jahre später mit einer gewissen Genugtuung, eine «allen Qualitätsansprüchen gerecht werdende Übersetzung beliebiger Texte» sei tatsächlich nicht in Sicht. Entweder fallen die Resultat dürftig aus oder der Mensch muss nachhelfen, indem er die Texte vorgängig für den Computer aufbereitet oder «durch eine gründliche Nachredaktion nach getanem Maschinenwerk» optimiert (1988, 185).
Dass es nach vier Jahrzehnten Forschung noch keine Maschine gebe, «die man mit egal welchen Texten allein lassen könnte», erst recht nicht mit stilistisch anspruchsvollen oder literarichen Texten, illustriert und kommentiert Zimmer am Beispiel der Anfangszeilen aus Joseph von Eichendorffs Gedicht «Das zerbrochene Ringlein» (1813).
In einem kühlen Grunde,
Da geht ein Mühlenrad
Selbst wenn der Computer imstande sei, morphologische und syntaktische Strukturen richtig zu erkennen, fehle ihm das semantische Wissen. Laut Zimmer käme dabei etwas heraus wie: In a cool reason since a mill wheel goes. Denn wie sollte der Computer auch wissen, «dass Grund hier nicht reason, sondern valley sein müsste, geht nicht goes, sondern turns, da nicht since, sondern there?»
Heute kennen wir die Antwort. Die maschinelle Übersetzung arbeitet nicht mit Analysen und lexikalischen Bedeutungen aus dem Wörterbuch, sondern mit algorithmisch produzierten Erwartbarkeiten. Ein Teil der von Zimmer befürchteten Defizite lassen sich auf diese Weise verhindern. Das ausgewählte Textstück ist zwar sehr kurz und bietet wenig Kontext, aber es ist einen Versuch wert, die Probe aufs Exempel zu machen. So habe ich die kurzen Gedichtzeilen aus Zimmers Beispiel in verschiedene frei zugängliche Übersetzungsmachinen gefüttert. Supertext, DeepL und Google Translate liefern folgende Vorschläge:
In a cool base
there goes a mill wheel
Als Alternativen für base werden von Suptertext ground, background, bottom, reason, soil, environment und depth angeboten. Die Vorschläge für goes sind nicht brauchbar.
In a cool ground
there goes a mill wheel
Als Varianten für ground werden von DeepL valley, glade, meadow, woods oder plain aufgeführt; für goes immerhin spins, rotates, turns, moves, flows …
Das auf Anhieb beste Ergebnis spuckt der Google-Übersetzer aus:
In a cool valley,
There turns a mill wheel
Mit einer Portion semantischem Weltwissen und sorgfältiger Nachredaktion kann man damit halbwegs arbeiten. Aber mit eigener Übersetzungsleistung käme man vermutlich schneller auf passable Lösungen.
Nun interessiert natürlich, wie die literarischen Humanübersetzer:innen die Aufgabe gemeistert haben? Hier drei Beispiele aus dem Netz:
William Ruleman (Poems for the Ages, 2019) ersetzt Eichendorffs Kreuzreime durch Paarreime. Auch das vorangestellt Verb in der zweite Zeile und die Entscheidung für vale unterstreicht die poetische Tonlage und weckt romantische Assoziationen (vergleichbar mit Deutschen Begriffen wie Aue oder Hain):
Down in a cool vale, still
Turns the wheel of a mill
Tia Caswell (Journal of Languages, Texts, and Society, Vol. 5 [2021], 5) weist in ihrem Kommentar darauf hin, dass es wie bei anderen Übertragungen auch bei diesem Eichendorff-Gedicht nicht möglich war, das Reimschema des Originals beizubehalten:
In a cool valley,
A mill wheel turns
Charles L. Cingolani (2024) verzichtet ebenfalls auf Reime. Dass hier aus dem beschaulichen Wiesen- oder Talgrund einfach ein Stück Land, wenn nicht gar ein Grundstück wird, stört die ländliche Idylle und will nicht so recht ins romantische Bild passen. Mit dem Humanübersetzer liesse sich aber bestimmt über semantische Feinheiten und Konnotationen diskutieren.
On a cool plot of land
There’s a mill wheel turning
Dieter E. Zimmers schlimmste Befürchtungen sind zwar nicht eingetreten, aber wie man sieht, haben die Übersetzungsmaschinen mächtig zugelegt und täuschen sprachliche Kompetenz vor – weshalb ich lieber von simulierter als von künstlicher Intelligenz spreche. Damion Searls hat sich jüngst in seiner Philosophy of Translation (2024) ebenfalls zur KI-Problematik geäussert. Seinem Fazit können wir uns hier anschliessen: Ein Text, der durch die KI-Übersetzung gejagt wurde, muss immer noch übersetzt werden.
Daniel Ammann, 15.7.2025
Searls, Damion. The Philosophy of Translation. New Haven, CT: Yale University Press, 2024.
Zimmer, Dieter E. «Wettbewerb der Übersetzer: Die einstweilige Unentbehrlichkeit des Humantranslators.» Redens Arten: Über Trends und Tollheiten im neudeutschen Sprachgebrauch. Zürich: Haffmans, 1988 (1986). S. 163–187.

